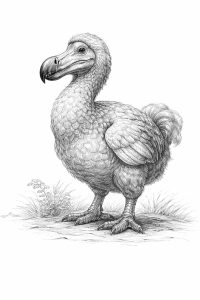12.01.2026, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
Typus-Genomik: DNA-Schatz in der Sammlung
Neue Studie zeigt, wie DNA aus Typusexemplaren die Biodiversitätsforschung revolutionieren kann. In einem gemeinsamen Appell plädiert ein internationales Forschungsteam, darunter Senckenberg-Wissenschaftler Prof. Dr. Steffen Pauls, für die gezielte und umfassende Genomsequenzierung von Typusexemplaren – den Referenz-Exemplaren einzelner Arten, die in naturkundlichen Sammlungen aufbewahrt werden.
In ihrem in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Systematic Biology“ veröffentlichten Beitrag betonen die Forschenden um Erstautor Dr. Harald Letsch (Universität Wien und Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe) die große Bedeutung der Entschlüsselung dieser genetischen Codes für die Biodiversitätsforschung und zeigen, wie sich durch modernste Technologien „digitale Zwillinge“ der oftmals historischen Museumsexemplare erstellen lassen.
In naturwissenschaftlichen Sammlungen auf der ganzen Welt lagert ein ungehobener Schatz: die DNA von sogenannten Typusexemplaren. Von jeder bekannten Art gibt es irgendwo auf der Welt ein Exemplar – ein Tier, eine Pflanze oder ein Fossil – das zur offiziellen Beschreibung und Benennung dieser Art verwendet wurde. Diese einmaligen und sorgsam aufbewahrten Objekte in den Sammlungen von Museen und Forschungseinrichtungen sind die „offiziellen Nachschlagewerke“ der Natur. Sie helfen Forschenden dabei, Arten eindeutig zu identifizieren und korrekt einzuordnen.
„Typusexemplare sind das Fundament unserer biologischen Namensgebung und unseres Artverständnisses“, erklärt der Erstautor des Artikels Dr. Harald Letsch von der Universität Wien und dem Naturkundemuseum Karlsruhe. „Wenn wir ihre Genome entschlüsseln, können wir besser verstehen, wie Arten miteinander verwandt sind, wie sie sich entwickelt haben – und wie wir sie schützen können.“
Doch die Zeit hinterlässt Spuren: Viele der Typusexemplare sind jahrhundertealt, empfindlich und gefährdet – durch Alterungsprozesse, unsachgemäße Lagerung oder Naturkatastrophen. Dank neuer Sequenzierungstechnologien ist es inzwischen möglich, genetische Informationen selbst aus sehr alten und fragilen Objekten zu gewinnen, ohne sie dabei zu zerstören.
Die Wissenschaftler*innen der Universität Wien und des Naturhistorischen Museums Wien, der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, des Museums für Naturkunde Berlin, des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels und weiterer Institutionen plädieren dafür, dass Sammlungs-Kurator*innen und Forschende aus den Bereichen der Taxonomie und Genomik verstärkt zusammenarbeiten, um das große Potenzial der „Typus-Genomik“ für die Biodiversitätsforschung nutzbar zu machen.
Ihr Appell ist Teil einer umfassenderen Bewegung zur Digitalisierung naturkundlicher Sammlungen. Die physische Unversehrtheit von Typusexemplaren zu bewahren, steht oft im Widerspruch zum Wunsch nach ihrer wissenschaftlichen Nutzung. Jede Untersuchung des physischen Exemplars oder dessen Ausleihen an andere Einrichtungen birgt Gefahren für die wertvollen Objekte. Moderne Technologien wie Hochdurchsatz-Sequenzierung auf Basis minimal-invasiver DNA-Entnahmemethoden und die Erstellung sogenannter „digitaler Zwillinge“ bieten hierfür neue Lösungsansätze: Hochauflösende Bilder, morphometrische Daten und genetische Informationen machen dabei die Eigenschaften der Typusexemplare für die Wissenschaft zugänglich, ohne die Originalexemplare zu gefährden.
„Technologien wie hochauflösende Bildgebung und minimal-invasive DNA-Entnahme verändern alles“, betont Dr. Steffen Pauls vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt und Seniorautor der Studie. „Wir können einmalig große Datenmengen aus einem Exemplar gewinnen – und diese Informationen dann global teilen, ohne das Original erneut zu belasten.“
„Der Aufbau datenreicher, umfassend digitalisierter Sammlungen durch Projekte wie die Typus-Genomik macht Biodiversitätsinformationen für die weltweite Forschung zugänglich und unterstreicht den Wert von Museumssammlungen als zentrale Forschungsinfrastruktur und lebendige Archive der Erdgeschichte“, ergänzt Dr. Jenna Moore vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels und Museum der Natur Hamburg.
Um die Zusammenarbeit zwischen Kurator*innen, Taxonom*innen und Genomforscher*innen zu fördern, entwirft das Team eine Strategie, mit der sich die Datengewinnung aus Typusexemplaren maximieren und gleichzeitig die Auswirkungen von DNA-Entnahme und anderen musealen Analyseverfahren minimieren lassen. „Zusammenarbeit ist der Schlüssel, um sowohl die Qualität als auch die Menge der Daten aus Typusexemplaren zu optimieren. Idealerweise wird ein Typusexemplar nur einmal physisch angefasst, um möglichst viele Informationen zu gewinnen“, so Pauls.
Museale Netzwerke sowie standardisierte DNA-Entnahmeprotokolle könnten künftig gewährleisten, dass genomische Daten aus Typusexemplaren weltweit verfügbar sind. Dr. Iker Irisarri vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels und dem Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) in Madrid betont: „Der Aufbau vernetzter Kataloge naturkundlicher Sammlungen kann die Beschreibung neuer Arten beschleunigen und die Erhaltung der Biodiversität gezielt unterstützen – vorausgesetzt, die entsprechenden Genomdaten sind offen zugänglich.“
Dr. Harald Letsch ist überzeugt: „Die Bereitstellung genomischer Informationen aus Typusexemplaren ist ein entscheidender Schritt in der digitalen Transformation naturkundlicher Sammlungen. Mit gemeinschaftlicher Expertise und moderner Technologie können wir die Forschung revolutionieren und biologisches Wissen für kommende Generationen bewahren.“
Originalpublikation:
Harald Letsch et al., Type genomics: a Framework for integrating Genomic Data into Biodiversity and Taxonomic research, Systematic Biology, Volume 74, Issue 6, November 2025, Pages 1029–1044 https://doi.org/10.1093/sysbio/syaf040 Weiterlesen →