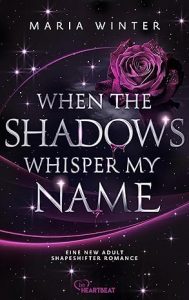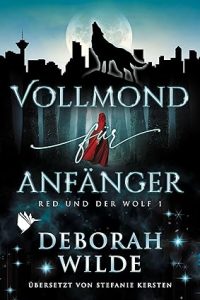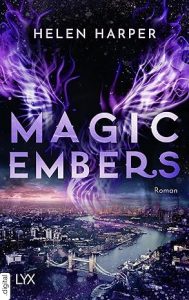| Klasse: | Vögel (Aves) |
| Ordnung: | Hühnervögel (Galliformes) |
| Familie: | Fasanenartige (Phasianidae) |
| Gattung: | Kammhühner (Gallus) |
| Art: | Bankivahuhn (Gallus gallus) |
| Unterart: | Haushuhn (Gallus gallus domesticus) |
Das Vorwerkhuhn ist eine Hühnerrasse deutschen Ursprungs. Obwohl es nicht mit dem deutschen Unternehmen, das den Staubsauger Vorwerk herstellt, verwandt ist, ist es das einzige Huhn, das seinen Namen mit einer Marke für Haushaltsgeräte teilt. Dieses seltene Huhn zeichnet sich durch sein charakteristisches schwarz-goldenes Gefieder aus.
Vorwerk-Hühner sind robuste, anpassungsfähige Tiere mit geringem Appetit. Sie sind aufmerksam und aktiv, aber nicht unbedingt scheu. Ihr Gefieder ist an Kopf, Hals und Schwanz einfarbig schwarz, der Rest ist gelblich-braun. Laut Rassestandard dürfen die gelblichen Bereiche keine schwarzen Flecken aufweisen, was in der Praxis jedoch sehr schwer zu züchten ist. Vorwerk-Hühner haben einen einfachen Kamm, schiefergraue Unterwolle und weiße Ohrscheiben.
Der Hahn hat ein ähnliches Gefieder wie die Henne. Vorwerk-Hühner sind Zweinutzungshühner, die sich sowohl für die Fleisch- als auch für die Eierproduktion eignen. Standardgroße Hähne wiegen 2,5–3,2 kg, Hennen 2–2,5 kg. Die europäischen Zwerghuhnstandards unterscheiden sich von den US-amerikanischen, was verständlich ist, da sie mit unterschiedlichen Rassen entwickelt wurden. [Quelle benötigt] So wiegen Zwerghuhnhähne in den USA 765 g und Hennen 650 g, während die Rasse in Europa mit 910 g für Hähne und 680 g für Hennen schwerer ist. Wenn Sie Ihre Hühner in Europa ausstellen möchten, sollten Sie sich an den europäischen Standards orientieren und nicht an den US-amerikanischen. Große Vorwerk-Hennen legen gute cremefarbene Eier und produzieren etwa 170 Eier pro Jahr. Weiterlesen