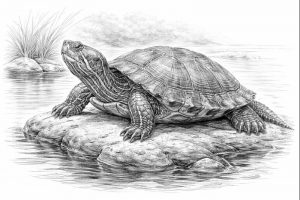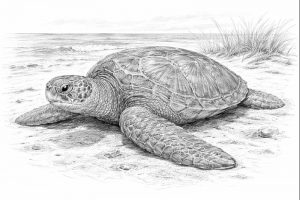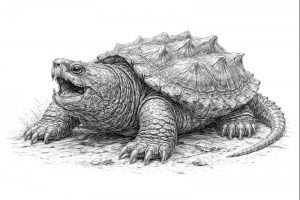Werbung
Eigentlich müsste ich jeden Link der zu Amazon verlinkt auch als solchen sichtbar machen... Aber: Dieser Blog enthält viel Werbung. Büchervorstellungen verlinken auf Verlage (und Amazon) Die Zoopresseschau enthält Werbung und eigentlich ist das ein reiner Werbeblog, jedenfalls könnte man das so sehen, denn jeder Link zu einem Zoo ist eine Art Werbung (ob der Zoo allerdings ein Produkt ist ...). Links, welche außerhalb meines Blogs führen, könnten Werbung enthalten. Man erkennt das, indem man mit der Maus über den gekennzeichneten Text fährt. Wohin man kommt ist dann ersichtlich. Und Amazonlinks (also Bücher) sind immer Werbung (und Teil eines Partnerprogramms) Aber: Ich erhalte kein Geld für meinen Blog (und wenn dann dient das dem Artenschutz. Ja, ich mache Werbung mit diesem Blog, aber wenn ich das nicht täte, wäre dieser Blog nur halb so informativ. Und seien wir mal ehrlich: Ist nicht fast alles, was nicht Nachrichten sind, Werbung? Interessante Beiträge zum Thema Blogger und Werbung findet man hier .Kommentare
Durch das Kommentieren eines Beitrags auf dieser Seite werden automatisch über Google personenbezogene Daten erhoben. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung. Mit dem Abschicken eines Kommentars wird die Datenschutzerklärung akzeptiert.Top-Beiträge und Top-Seiten
-
Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
Archiv
Kategorien
Blog via E-Mail abonnieren
Schließe dich 23 anderen Abonnenten anFolge mir auf Facebook
Folge mir auf Instagram
-
Datenschutz und Cookies: Diese Website verwendet Cookies. Wenn du die Website weiterhin nutzt, stimmst du der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen, beispielsweise zur Kontrolle von Cookies, findest du hier: Cookie-Richtlinie Meta
Fröhliche Weihnachten/Merry Christmas/Joyeux Noël!/Feliz Navidad
Veröffentlicht unter Uncategorized
Schreib einen Kommentar
Tiere verschenken an Weihnachten?
 Alle Jahre wieder kommt die Frage, was man an Weihnachten verschenken soll. Und auf manchem (kindlichen) Wunschzettel steht ein Haustier. Aber … egal ob Hund, Katze, Hamster & Co., der Kauf eines Tieres will wohl überlegt sein und nach Meinung vieler Tierschützer (und Tierrechtler) gehören Tiere nicht unter den Weihnachtsbaum (allerdings kann es sehr unterhaltsam sein, dem vorhanden Hund oder der Katze ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum zu machen, aber das ist ein ganz anderes Thema).
Alle Jahre wieder kommt die Frage, was man an Weihnachten verschenken soll. Und auf manchem (kindlichen) Wunschzettel steht ein Haustier. Aber … egal ob Hund, Katze, Hamster & Co., der Kauf eines Tieres will wohl überlegt sein und nach Meinung vieler Tierschützer (und Tierrechtler) gehören Tiere nicht unter den Weihnachtsbaum (allerdings kann es sehr unterhaltsam sein, dem vorhanden Hund oder der Katze ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum zu machen, aber das ist ein ganz anderes Thema).
Ich bin mir sicher, dass sich auch andere Organisationen (noch) zu Wort melden werden (oder es bereits getan haben).
Übrigens: Das Bild wurde für die Aktion „Keine lebenden Tiere unter den Weihnachtsbaum“ entworfen.
Weiterlesen
Veröffentlicht unter Uncategorized
Ein Kommentar
Ein paar Bemerkungen
Bei Abbildungen, die mit Hilfe von ChatGPT entstanden sind, besteht kein Anspruch auf Korrektheit. Es handelt sich um Rekonstruktionen, die Fehler enthalten können.
Dieser Blog enthält Werbung. Jeder Link außerhalb dieses Blogs kann Werbung enthalten (das schließt auch Links zum Buchgelaber ein).
Links zu Amazon (das betrifft viele Bücherlinks) sind Affiliate Links. „Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.“ (davon profitiert allerdings der Artenschutz)
Mehr zum Thema Werbung findet man auf der Bildschirmseite rechts. Weiterlesen
Veröffentlicht unter Uncategorized
Ein Kommentar
Arche-Zoo Braunschweig
- EIngang (Arche-Zoo Braunschweig)
- Nasenbärenanlage (Arche-Zoo Braunschweig)
- Baumstachleranlage (Arche-Zoo Braunschweig)
- Arche-Zoo Braunschweig
- Arche-Zoo Braunschweig
- Arche-Zoo Braunschweig
- Arche-Zoo Braunschweig
- Arche-Zoo Braunschweig
- Kattaanlage (Arche-Zoo Braunschweig)
Veröffentlicht unter Uncategorized
Schreib einen Kommentar
11. Zooreise 2025 – Dresden
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, also die letzte Gelegenheit zwischen den Jahren (wie es so schön heißt) den Reisekoffer zu packen und ein paar Zoos unsicher zu machen. Es wird kalt, aber die Wettervorhersagen zeigen keinen Regen, also… warm anziehen und durch.
Das Ziel: Dresden, wobei wir auch einen Abstecher nach Halle machen (schon wieder, immerhin ging die letzte Reise ja schon dorthin).
Morgen geht es los … und erst einmal nach Halle. Weiterlesen
Veröffentlicht unter Zoo-Reise
Schreib einen Kommentar
TTT: 10 Bücher mit einem winterlichen Cover (Schnee/Weihnachten ect)
Veröffentlicht unter Top Ten Thursday
9 Kommentare
Hans-Peter Hutter/Raoul Mazhar: Parasiten – Meister der Manipulation (Rezension)
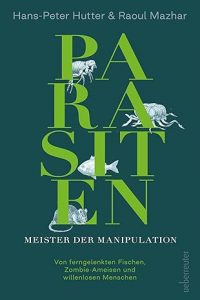 Parasiten sind keine Randerscheinung – sie beeinflussen die Gesundheit, Evolution und das Zusammenleben von Menschen und Tieren. Das Buch zeigt, wie stark unser Alltag von ihnen geprägt ist, ohne dass wir es bemerken.
Parasiten sind keine Randerscheinung – sie beeinflussen die Gesundheit, Evolution und das Zusammenleben von Menschen und Tieren. Das Buch zeigt, wie stark unser Alltag von ihnen geprägt ist, ohne dass wir es bemerken.
Eine Ameise erklimmt mit erstaunlicher Präzision die exakte Höhe eines Grashalmes, beißt zu und wartet – pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk – bis sie gefressen wird. Eine Maus verliert ihre Angst und spaziert todesmutig in den Rachen einer Katze. Ein Fisch tauscht seine Zunge gegen einen blutsaugenden Untermieter und macht pflichtbewusst weiter. Die Regisseure dieser Szenen? Parasiten: unscheinbar, hochspezialisiert und erstaunlich angepasst.
In »Parasiten – Meister der Manipulation« werfen Hans-Peter Hutter und Raoul Mazhar einen ebenso vergnüglichen wie kenntnisreichen Blick darauf, wie Mikroorganismen Verhalten umprogrammieren, Körper kapern und Evolutionsgeschichte mitschreiben: wissenschaftlich präzise, mit trockenem Witz und oft makaber komisch. Weiterlesen
Veröffentlicht unter Rezension
Schreib einen Kommentar
Fabian Navarro: Miez Marple und die Kralle des Bösen
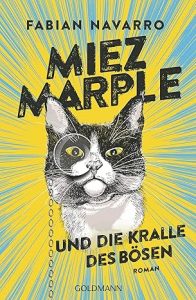 Aus gutem Grund hat Katzendetektivin Miez Marple beschlossen, das komfortable Leben einer Wohnungskatze zu führen. Wäre da nicht ihr guter Freund Kater Watson, der bei seinen Ermittlungen gegen die Betreiber eines Katzengras-Onlineshops auf ein haarsträubendes Verbrechen gestoßen ist und nun in Schwierigkeiten steckt: in einer Zelle der Katzenpolizei. Als Mordverdächtiger. Schon zwitschern es die Vögel von den Dächern und auch die Bellt-Zeitung berichtet: Miez Marple ermittelt! Wird es der flauschigen Detektivin gelingen, Watson zu retten und die Stadt davor zu bewahren vor die Hunde zu gehen? Weiterlesen
Aus gutem Grund hat Katzendetektivin Miez Marple beschlossen, das komfortable Leben einer Wohnungskatze zu führen. Wäre da nicht ihr guter Freund Kater Watson, der bei seinen Ermittlungen gegen die Betreiber eines Katzengras-Onlineshops auf ein haarsträubendes Verbrechen gestoßen ist und nun in Schwierigkeiten steckt: in einer Zelle der Katzenpolizei. Als Mordverdächtiger. Schon zwitschern es die Vögel von den Dächern und auch die Bellt-Zeitung berichtet: Miez Marple ermittelt! Wird es der flauschigen Detektivin gelingen, Watson zu retten und die Stadt davor zu bewahren vor die Hunde zu gehen? Weiterlesen
Veröffentlicht unter Rezension
Schreib einen Kommentar
Naomi Novik: Drachenprinz (Rezension)
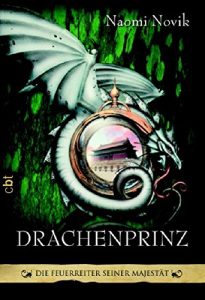 Kaum haben Captain Will Laurence und sein gewaltiger Drache Temeraire ihre erste Bewährungsprobe bestanden, da erscheint eine chinesische Delegation am britischen Königshof und fordert die Rückgabe Temeraires. Als Laurence sich weigert, muss er seinen geliebten Gefährten in den fernen Osten begleiten – ohne zu ahnen, was ihn und Temeraire am Ende ihrer langen, gefahrvollen Reise erwartet …
Kaum haben Captain Will Laurence und sein gewaltiger Drache Temeraire ihre erste Bewährungsprobe bestanden, da erscheint eine chinesische Delegation am britischen Königshof und fordert die Rückgabe Temeraires. Als Laurence sich weigert, muss er seinen geliebten Gefährten in den fernen Osten begleiten – ohne zu ahnen, was ihn und Temeraire am Ende ihrer langen, gefahrvollen Reise erwartet …
DRACHENPRINZ ist der zweite Teil der pseudohistorischen Fantasyreihe DIE FEUERREITER IHRER MAJESTÄT. Und es geht spannend weiter. Ich will nicht sagen, dass DRACHENPRINZ besser oder schlechter als DRACHENBRUT ist, der Band stellt eine konsequente Fortführung der Ereignisse dar. Weiterlesen
Veröffentlicht unter Rezension
Schreib einen Kommentar
Annabel Chase: Spellbound 8 – Dreimal Schwarzer Zauber (Rezension)
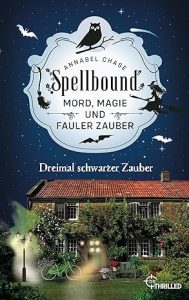 Emma und ihre Freundinnen aus dem Hexen-Nachhilfeunterricht machen einen aufsehenerregenden Fund! Durch Zufall entdecken sie in einem alten Grimoire eine geheime Buchseite. Darauf könnte sich ein Hinweis befinden, mit dem sich der Fluch von Spellbound endlich brechen lässt. Emma stürzt sich in diese Aufgabe. Doch sie ahnt nicht, welche Gefahren dabei auf sie warten …
Emma und ihre Freundinnen aus dem Hexen-Nachhilfeunterricht machen einen aufsehenerregenden Fund! Durch Zufall entdecken sie in einem alten Grimoire eine geheime Buchseite. Darauf könnte sich ein Hinweis befinden, mit dem sich der Fluch von Spellbound endlich brechen lässt. Emma stürzt sich in diese Aufgabe. Doch sie ahnt nicht, welche Gefahren dabei auf sie warten …
Und als wäre das nicht genug, stolpert sie während eines Besuchs bei Agnes im Spellbound-Pflegeheim über die Leiche eines alten Satyrs. Emma hofft, dass wenigstens dieses eine Mal jemand eines natürlichen Todes gestorben ist. Doch hat sie wirklich so viel Glück?
DREIMAL SCHWARZER ZAUBER – Teil 8 der amüsanten CosyFantasyKrimireihe. Weiterlesen
Veröffentlicht unter Rezension
Schreib einen Kommentar
Sy Montgomery: Tête-à-Tête mit einer Schildkröte (Rezension)
- Schmuckschildkröte (ChatGPT)
- Suppenschildkröte (ChatGPT)
- Schnappschildkröte (ChatGPT)
Veröffentlicht unter Rezension
Schreib einen Kommentar