30.06.2025, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Wie Ameisen sich aktiv vor Wasserverlust schützen
Insekten schützen sich mit einer Wachsschicht vor dem Austrocknen – darüber hinaus dient sie aber auch zur Kommunikation. Während die chemischen Eigenschaften dieser Kohlenwasserstoff-Schicht bereits recht gut untersucht sind, haben Forschende der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) und der Universität Paris nun erstmalig die physikalischen Eigenschaften analysiert – genauer gesagt die Viskosität, also die Zähflüssigkeit. Ihre Ergebnisse haben die Forschenden am 11. Juni 2025 im renommierten Wissenschaftsmagazin Journal of the Royal Society Interface veröffentlicht.
Die Erkenntnisse tragen zum Verständnis der physikalischen Mechanismen bei, die den biologischen Funktionen der Wachsschicht zugrunde liegen.
„Anhand von Ameisen konnten wir zeigen, dass es nicht nur eine feste und eine flüssige Phase gibt, sondern dass auch die flüssige Phase zwei verschiedene Viskositäten besitzt: Einen dickflüssigen Teil, dessen Fließverhalten dem von Honig gleicht, sowie eine dünnflüssige Phase, die eher an Olivenöl erinnert“, sagt Priv.-Doz. Dr. Florian Menzel von der JGU. „Auf diese Weise können die verschiedenen Funktionen der Wachsschicht gleichzeitig erfüllt werden, auch bei schwankenden Temperaturen.“
Die Anforderungen an die Wachsschicht widersprechen einander
Der Insektenbestand nimmt derzeit drastisch ab – was auch auf die globale Erwärmung zurückzuführen ist. Schließlich ist Hitze für Insekten besonders gefährlich, da ihre Oberfläche im Vergleich zum Körpervolumen sehr groß ist und sie somit sehr viel Flüssigkeit über ihren Chitinpanzer verlieren. Die Wachsschicht soll dies verhindern: Sie bildet eine Barriere, die die Wassermoleküle nur schwer passieren können. Je zähflüssiger sie ist, desto größer der Schutz gegen Wasserverlust. Doch enthält sie auch Kommunikationssignale, die von anderen Ameisen wahrgenommen werden und auf denen das Zusammenleben in einer Ameisenkolonie basiert. Für diese chemische Kommunikation untereinander muss die Wachsschicht jedoch möglichst dünnflüssig sein, damit die Hinweise gut wahrgenommen werden können.
Komplexes Phasenverhalten sorgt für die passende Viskosität
Wie verändert sich die Fließfähigkeit der schützenden Schicht mit der Temperatur? Um diese Frage zu beantworten, haben die Forschenden die Wachsschicht von Ameisen bei verschiedenen Messtemperaturen untersucht. Das Ergebnis: Wie bei allen Flüssigkeiten sinkt die Viskosität mit steigender Temperatur – ähnlich wie Honig beim Erwärmen dünnflüssiger wird.
Einen interessanten Effekt entdeckte das Team allerdings, als es die Wachsschichten von Ameisen untersuchte, die bei verschiedenen Temperaturen gehalten wurden – also bei unterschiedlichen Akklimatisierungstemperaturen. „Bei diesen Wachsschichten trat ein umgekehrter Effekt auf: Hatte die Umgebung der Ameisen eine Temperatur von 28 Grad Celsius, war die Viskosität größer und die Schicht zähflüssiger als bei einer Akklimatisierungstemperatur von 20 Grad“, fasst Selina Huthmacher von der JGU die Ergebnisse zusammen. Sinn ergibt das allemal: Je heißer es ist, desto mehr Flüssigkeit verdampft. Die Insekten müssen sich mit steigenden Temperaturen also stärker gegen den Wasserverlust schützen, was mit einer zähflüssigeren Schutzschicht gelingt. „Die Insekten arbeiten also aktiv gegen die natürliche Viskositätsänderung, indem sie die chemische Zusammensetzung der Wachsschicht und damit ihre Fließfähigkeit ändern“, sagt Menzel.
Bei den oben beschriebenen Ansätzen untersuchten die Forschenden, wie sich Änderungen entweder der Akklimatisierungstemperatur oder aber der Messtemperatur auf die Viskosität auswirken. Noch komplexer wird es, wenn man die Akklimatisierungstemperatur und die Messtemperatur gleichermaßen ändert: Wurden die Ameisen bei 28 Grad gehalten und die Schicht bei 28 Grad gemessen, entsprach die Viskosität derjenigen bei 20 Grad Akklimatisierungstemperatur und 20 Grad Messtemperatur. „Dieses komplexe Phasenverhalten ist äußerst spannend“, sagt Huthmacher. „Dadurch kann die Wachsschicht der Insekten sowohl als Austrocknungsschutz als auch zur Kommunikation dienen – obwohl beide Funktionen jeweils gegensätzliche Anforderungen stellen.“
Originalpublikation:
S. Huthmacher, B. Abou, F. Menzel, The importance of being heterogeneous: the complex phase behaviour of insect cuticular hydrocarbons, Journal of the Royal Society Interface 22: 227, 11. Juni 2025, DOI: 10.1098/rsif.2025.0099
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2025.0099
30.06.2025, Georg-August-Universität Göttingen
Vertragen sich Eichhörnchen und Schlafmäuse?
Kommen Tierarten, die in Baumkronen leben, miteinander aus? Ein Forschungsteam der Universität Göttingen hat gezeigt, dass Wälder, in denen verschiedene Arten von Laub- und Nadelbäumen kombiniert werden, das Zusammenleben von Eichhörnchen und Schlafmäusen, auch Bilche genannt, begünstigen. Mithilfe von Kameras in Baumkronen fanden die Forschenden heraus, dass rote Eichhörnchen Nadelwälder bevorzugen, während Schlafmäuse, wie etwa der Siebenschläfer oder die Haselmaus, eher in Buchenwäldern zu finden sind. In Wäldern mit einer Kombination aus beiden Baumarten kamen jedoch beide Tierarten vor, was darauf hindeutet, dass Mischwälder zur Förderung der Artenvielfalt beitragen können.
Die Ergebnisse wurden im European Journal of Wildlife Research veröffentlicht.
Die Studie wurde in Norddeutschland durchgeführt und umfasste 80 Kameras, die in unterschiedlichen Höhen an Bäumen angebracht waren: Von 2 Metern über dem Boden bis hin zu 30 Metern Höhe. Dazu mussten die Forschenden mit Hilfe professioneller Baumkletterer auf jeden Baum klettern, um die Kameras in den Baumkronen zu installieren, zu inspizieren und zu bergen. Die Kameras zeichneten Tiere automatisch auf und wurden durch Bewegung und Wärme aktiviert, wenn Tiere ihr Sichtfeld passierten. Während der siebenmonatiger Beobachtungszeit wurden in 20 verschiedenen Wäldern 468 Sichtungen von Eichhörnchen und 446 von Schlafmäusen registriert. Unter den Sichtungen der Schlafmäuse waren es 249 Siebenschläfer und 197 Haselmäuse. Anhand dieser Daten konnten die Forscher die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens der einzelnen Arten im Zusammenhang mit der Anzahl der Buchen und der Präsenz anderer Baumsäugetierarten berechnen.
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass Schlafmäuse und Eichhörnchen einander nicht aus dem Weg gehen. Sie können in Mischwäldern sogar recht gut zusammenleben“, so Erstautor Pedro Mittelman, Doktorand in der Abteilung Wildtierwissenschaften der Universität Göttingen. „Das ist eine großartige Nachricht, denn sie zeigt, dass forstwirtschaftliche Praktiken, die Baumarten kombinieren, der Tierwelt zugute kommen können“. Das Forschungsteam unterstreicht die Bedeutung von Mischwäldern in der Forstwirtschaft als eine Möglichkeit, die biologische Vielfalt auch in einem Umfeld der Holzproduktion zu erhalten.
Die Forschung im Graduiertenkolleg „Der Einfluss funktionaler Eigenschaften beigemischter Koniferen auf die Funktionsweise von Rotbuchenökosystemen“ (EnriCo) an der Universität Göttingen wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert und ist Teil der laufenden Bemühungen, die Funktionsweise von reinen und gemischten Waldökosystemen besser zu verstehen
Originalpublikation:
Originalveröffentlichung: Mittelman P, Pineda M, Balkenhol N (2025): Mixed broadleaf-conifer forests promote coexistence of red squirrels and doormice. European Journal of Wildlife Research, 71:67. DOI: http://10.1007/s10344-025-01947-y
30.06.2025, Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) e. V.
Bartgeier-Odyssee beendet: Vinzenz kehrt in die Alpen zurück
Nach 1.600 Kilometern Ausflug: Vinzenz wieder im Nationalpark Berchtesgaden – Bartgeier Luisa erfolgreich ausgeflogen
Der junge Bartgeier Vinzenz ist nach einem außergewöhnlichen Abstecher in den hohen Norden wieder zurück in seiner Heimatregion: Im Nationalpark Berchtesgaden konnte er nun erneut erfolgreich in die Freiheit entlassen werden. Im Hagengebirge nahe der österreichischen Grenze holten die Projektverantwortlichen des bayerischen Naturschutzverbands LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) und des Nationalparks Berchtesgaden Vinzenz heute Morgen aus seiner Transportbox. Nach dem Öffnen der Türen dauerte es nur wenige Sekunden, bis Vinzenz die Box selbstständig verlies und sich zielsicher in seiner vertrauten alpinen Umgebung in die Lüfte schwang. Auch die Ende Mai ausgewilderte Bartgeierdame Luisa sorgt für Freude: Sie flog bereits vergangenen Sonntag, 22. Juni zum ersten Mal erfolgreich aus der Felsnische aus.
Zuvor hatte Vinzenz über mehrere Wochen für Aufregung gesorgt: Der 2024 im Rahmen des Wiederansiedlungsprojekts ausgewilderte Bartgeier hatte sich überraschend auf einen über 1.600 Kilometer langen Flug begeben – von den bayerischen Alpen über Süddeutschland bis in die Niederlande und schließlich an die Nordseeküste bei Oldenburg. Dort wurde er Mitte Juni an einer Landstraße eingefangen und in die auf Greifvögel spezialisierte Wildtierauffangstation in Rastede gebracht. „Vinzenz hatte auf seinem Flug rund zehn Prozent seines Körpergewichts verloren, war aber glücklicherweise unverletzt“, erklärt Toni Wegscheider, Projektleiter beim LBV. „Er wurde in Rastede bestens versorgt, gründlich untersucht und schonend wieder aufgepäppelt.“ Neben der erhofften Gewichtszunahme wurden auch medizinische Checks, insbesondere zur Abklärung von Bleibelastung, durchgeführt – alle Befunde waren unauffällig.
Nachdem sich Vinzenz vollständig erholt hatte, erfolgte nun sein Rücktransport mit einem spezialisierten Tiertransportunternehmen zurück in den Nationalpark Berchtesgaden. „Seine seit dem letzten Jahr gewonnenen Erfahrungen machen uns zuversichtlich, dass Vinzenz sich wieder gut in den Alpen zurechtfinden wird“, so Ulrich Brendel, Projektleiter im Nationalpark. Der junge Bartgeier trägt weiterhin einen GPS-Sender, über den seine künftigen Wege beobachtet werden können. „Wir hoffen, dass Vinzenz in Zukunft wieder vorwiegend in alpinen Regionen unterwegs ist – die Risiken im Flachland sind für diese Vogelart einfach zu groß“, betont Brendel.
Auch Bartgeier Luisa erobert die Lüfte
Für weitere schöne Nachrichten sorgt die in diesem Jahr ausgewilderte Bartgeierdame Luisa. Am Sonntag, 22. Juni absolvierte nun auch sie im Alter von 117 Tagen erfolgreich ihren Erstflug aus der Felsnische im Klausbachtal. Im Gegensatz zu ihrer Artgenossin Generl, die bereits zehn Tage zuvor und damit außergewöhnlich früh in die Lüfte gestartet war, ließ sich Luisa ausreichend Zeit für das Training der Flügelschläge. Sie zeigte einen bemerkenswerten Steilflug und landete etwas ruppig in der Wiese neben der Auswilderungsnische. „Möglicherweise wurde Luisa neben den gelegentlichen Übungsflügen von Generl auch von der Präsenz des 2023 ausgewilderten Nepomuk animiert. Dieser hatte sich einen Tag zuvor zu einem Besuch in der Halsgrube eingefunden und hielt sich über mehrere Tage friedlich in der Nähe der beiden Junggeier auf“, berichtet Toni Wegscheider. Das Bartgeier-Team konnte auch beobachten, dass Nepomuk das im Gebiet ansässige Steinadlerpaar aus der Halsgrube vertrieben hat und somit konnte er den noch nicht so versierten Junggeiern etwas den Rücken freihalten. Das Projektteam hofft, dass sich die beiden Anfängerinnen vom erfahrenen Flieger möglichst viele Tricks abschauen, um schon bald ebenso souverän wie er durch den Nationalpark zu segeln.
Bartgeier auf Reisen
Die beeindruckende Flugroute von Vinzenz durch Deutschland und die Niederlande sowie seine nächsten Flüge können auf der Webseite des LBV mitverfolgt werden unter www.lbv.de/bartgeier-auf-reisen. Dort lassen sich auch die aktuellen Flugrouten der sechs anderen mit Sendern ausgestatteten Bartgeier sowie die kommenden Ausflüge von Generl und Luisa, sobald sie im Spätsommer das Klausbachtal verlassen haben, entdecken.
01.07.2025, Deutsche Wildtier Stiftung
Seltene Schreiadlerküken geschlüpft – nationales Artenhilfsprogramm „Gemeinsam für den Schreiadler“ schützt den Nachwuchs und seine Eltern
Stück für Stück zupft die Schreiadlermutter ihre Beute in kleine Häppchen und übergibt sie behutsam dem Schnabel ihres Kükens. Die beiden Tiere sitzen in einem Nest aus Reisig und Laub. In der Krone eines Nadelbaums im lettischen Staatswald wiegt es sich sanft hin und her. Eine schöne Szene, die dem menschlichen Auge normalerweise verborgen bleibt. Doch dank einer Webcam können Wildtierfreunde an dem faszinierenden Naturschauspiel teilhaben. Die Kamera wurde von der Staatlichen Forstverwaltung im lettischen Naturreservat Teici installiert – zu sehen ist der Livestream auf der Website der Deutschen Wildtier Stiftung. Neben den seltenen Einblicken in das Familienleben eines Schreiadlers liefert die Webcam auch wertvolle wissenschaftliche Daten, zum Beispiel zur Nahrungsmenge, die die Altvögel zum Nest tragen. Das sind auch wichtige Informationen für das nationale Artenhilfsprogramm „Gemeinsam für den Schreiadler“.
Lettland gilt als Kerngebiet der weltweiten Schreiadlerverbreitung. Rund 3.500 Brutpaare gibt es dort – auf einer Landesfläche, die noch nicht einmal einem Fünftel der Fläche Deutschlands entspricht. Hierzulande gibt es gerade einmal 130 Brutpaare: 100 in Mecklenburg-Vorpommern, 30 in Brandenburg. Geeignete Lebensräume für Deutschlands kleinsten Adler werden durch die intensive Land- und Forstwirtschaft immer seltener. Zusätzlich sind Schreiadler von den Folgen des Klimawandels betroffen. Das Frühjahr 2025 war in den Brutgebieten in Nordostdeutschland extrem trocken. Im Mai fielen weniger als 40 Millimeter Regen pro Quadratmeter. „Feuchtgebiete, nasse Wiesen und Bruchwälder sind die Lebensräume von Fröschen – neben Mäusen die Hauptnahrung des Schreiadlers. Daher hat er seine Horste in der Nähe solcher Gebiete“, sagt Christiane Röttger, Leiterin des Schreiadlerteams bei der Deutschen Wildtier Stiftung. Wenn es zu trocken ist, brechen die Amphibienbestände ein. Ohnehin ist die Hälfte der Amphibienarten in Deutschland bereits vom Aussterben bedroht, auch aufgrund des Klimawandels.
Paradoxerweise sind die seltenen Adler gleichzeitig von Maßnahmen betroffen, mit denen der Klimawandel bekämpft werden soll. „Schreiadler leiden doppelt: zum einen unter dem Klimawandel und zum anderen unter dem Ausbau der Windkraft als Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Röttger. Wegen des knappen Nahrungsangebots müssen sie weitere Strecken zurücklegen, um ausreichend Beute zu finden. Damit steigt weiter das Kollisionsrisiko mit Windkraftanlagen. Mindestens elf Schreiadler fielen in den vergangenen Jahren in Deutschland Windkraftanlagen zum Opfer – ein schwerwiegender Verlust, denn für den Erhalt der Art zählt jeder einzelne Altvogel.
Die Deutsche Wildtier Stiftung hat 2024 gemeinsam mit der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe und der Stiftung Umwelt und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern das nationale Artenhilfsprogramm „Gemeinsam für den Schreiadler“ gestartet. Ziel ist es, den Bruterfolg durch besseren Schutz und intensivere Betreuung der Brutwälder zu steigern und die Nahrungsgebiete der Schreiadler zu verbessern – beispielweise durch Wiedervernässung trockengelegter Moore, Feuchtwiesen und Sölle, den Rückbau von Entwässerungsgräben sowie das Pflanzen von Hecken und Gehölzinseln. Dass sich die Mühe lohnt, zeigt sich auf dem Stiftungsgut der Deutschen Wildtier Stiftung in Klepelshagen: Dort hat die Stiftung zahlreiche Maßnahmen zur Wiederherstellung von Feuchtgebieten umgesetzt. Schreiadler nutzen das Gebiet gerne zur Jagd. Und letztes Jahr wurde dort erstmals seit 22 Jahren wieder ein Schreiadlerküken flügge.
01.07.2025, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns
Von der Paläogeografie gezeichnet – eine neue Weltkarte der Meeresmollusken
Temperatur in Kombination mit Ozeanströmungen haben einen wesentlichen Einfluss auf die Verteilung mariner Lebewesen. Der stete Wandel der Land-Meerverteilung auf der Erdoberfläche prägen diese Strömungsmuster. SNSB-Wissenschaftler Thomas A. Neubauer korrelierte in einer neuen Studie über 3 Millionen Beobachtungsdaten heutiger bodenlebender Mollusken aus den Schelfgebieten der Weltmeere mit der Entwicklung heutiger Meeresströmungen während der jüngeren Erdgeschichte. Seine Ergebnisse publizierte das Forscherteam jüngst in der Fachzeitschrift Scientific Reports.
Biogeographische Regionen mariner Lebewesen, das heißt deren Verteilung auf unterschiedliche Lebensräume, überlappen oft gut mit den großen globalen Meeresströmungen. Dabei spielt das erdgeschichtliche Alter der Strömungen eine große Rolle. Die Strömungsmuster auf der Erde sind stark an die Verteilung der Kontinente geknüpft. Viele Strömungen, wie auch Landbrücken oder Meeresstraßen, sind erst vor wenigen Millionen Jahren entstanden. Andere liegen viele Millionen Jahre zurück. Ihr unterschiedliches Entstehungsalter in der Erdgeschichte hat unterschiedlich starken Einfluss auf die Verbreitungsgebiete heutiger mariner Mollusken. Dies zeigt eine neue statistische Studie um den SNSB-Paläontologen Thomas A. Neubauer von der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie (SNSB-BSPG).
Ein Beispiel ist die Schließung der Landenge von Panama vor 2,8 Millionen Jahren: Ihr vergleichsweise junges geologisches Alter ist immer noch in der Ähnlichkeit der Molluskenfaunen des tropischen Ost-Pazifiks und West-Atlantiks sichtbar. Deutlich stärker ist dagegen der Unterschied der Faunen des West- und des Ost-Atlantik, unter anderem weil die Öffnung des atlantischen Ozeans mehr als 100 Millionen Jahre zurückliegt.
Thomas A. Neubauer und seine Kollegen publizierten jetzt eine neue Übersichtskarte der geografischen Verbreitung heutiger Weichtiere wie Muscheln und Schnecken in den Schelfgebieten der Meere weltweit. Die Forscher korrelierten darin über 3 Millionen Verbreitungsdaten der Tiere mit Daten zur Meerestemperatur sowie mit dem Verlauf der globalen Meeresströmungen, insbesondere mit Blick auf deren geologische Geschichte. Ihre Analysen belegen: Temperatur sowie Meeresströmungen und deren paläogeografische Entwicklungsgeschichte haben einen erheblichen Einfluss auf das Leben in flachen Meeresgewässern. Dabei sind beide Faktoren eng miteinander verflochten: Die globalen Meeresströmungen heute orientieren sich an der Umgestaltung von Land und Meer während der letzten Millionen Jahre und wirken sich damit auch auf die Temperaturverteilung entlang der Schelfgebiete aus.
Eine große Gefahr sehen die Autoren der Studie auch im aktuell rasch fortschreitenden Klimawandel. „Temperatur beeinflusst das Leben im Meer immens. Sie steuert Stoffwechselfunktionen, Fortpflanzung oder Lebenszyklus mariner Lebewesen ebenso wie evolutionäre Prozesse, wie Artentstehung oder -aussterben. Die rasche Klimaerwärmung verändert schon jetzt die Temperaturen der Meeresoberfläche, was sich wiederum auswirkt auf Meeresströmungen. Das hat Konsequenzen für die Biologie und Lebensräume mariner Arten und in der Folge auf ganze Ökosysteme“, sagt Thomas A. Neubauer, Hauptautor der Studie.
Die Beobachtungsdaten der Mollusken für ihre Arbeit stammen aus den beiden Biodiversi-täts-Datenbanken Global Biodiversity Information Facility (GBIF, https://www.gbif.org/) und Ocean Biodiversity Information System (OBIS, https://obis.org/). An der Studie beteiligt waren auch Forscher des Naturhistorischen Museums Wien sowie der Universität Malaga.
Originalpublikation:
Neubauer, T.A., Gofas, S. & Harzhauser, M. Biogeographic patterns of modern benthic shallow-water molluscs and the roles of temperature and palaeogeographic legacy. Sci Rep 15, 20304 (2025). https://doi.org/10.1038/s41598-025-06473-0
02.07.2025, Humboldt-Universität zu Berlin
Wie Quallen schwimmen: HU-Studie erklärt Zusammenhang von Nervennetzen und Muskelaktivierung
Von den biophysikalischen Eigenschaften der einzelnen Zellen bis zur Bewegung des gesamten Körpers – Studie der Humboldt-Universität zu Berlin erklärt, wie Quallen ihre Fortbewegung steuern
Berlin, den 2. Juli 2025. Wassertiere benötigen präzise koordinierte Bewegungen, um sich effizient durch offene Gewässer zu bewegen. Quallen, die vorwärts schwimmen, indem sie ihren Schirm zusammenziehen und Wasser ausstoßen, müssen außerdem auf Sinnesreize an der Außenhaut ihres glockenförmigen Körpers reagieren, um Jagd oder Flucht einzuleiten. Wie sie ihre einfachen Nervennetze zur Muskelaktivierung nutzen, ist bisher nicht genau verstanden.
Anhand eines mathematischen Modells haben Fabian Pallasdies und Kolleg*innen aus der Arbeitsgruppe Theoretische Neurophysiologie von Prof. Dr. Susanne Schreiber am Institut für Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) nun die Kopplung von neuronaler Aktivität und motorischer Reaktion bei diesen Schwimmbewegungen untersucht. In ihrer Studie, die in der Fachzeitschrift Journal of Neuroscience erschienen ist, decken sie das ausgeklügelte zeitliche Zusammenspiel von Nerven- und Muskelzellen auf, welches eine schnelle Kontraktion der Muskeln bewirkt und Quallen so ermöglicht, stabil und taumelfrei zu schwimmen. Die Studie liefert ein seltenes Beispiel für eine vollständige mechanistische Erklärung des Verhaltens von Tieren – von den biophysikalischen Eigenschaften der einzelnen Zellen bis hin zur Bewegung des gesamten Körpers.
Kombination von Nerven-, Muskel- und fluid-mechanischer Simulation
Für ihre Studie nutzten die Forschenden ein mathematisches Modell, das nicht nur die elektrische Aktivität des Nerven- und Muskelsystems der Rotaugen-Qualle simuliert, sondern auch den glockenförmigen Körper des Tieres und wie dieser während des Schwimmens mit dem Wasser in Wechselwirkung tritt. Diese Kombination aus Nerven-, Muskel- und fluid-mechanischer Simulation zeigte, dass es insbesondere die schnelle, symmetrische Muskelkontraktion ist, die Quallen beim Schwimmen stabilisiert. Anhand der Simulation lässt sich außerdem erkennen, wie die Muskelkontraktion erreicht wird: Wird die Qualle an einer beliebigen Stelle ihres Körpers stimuliert, ziehen sich die ringförmigen, um den Körper verlaufenden Muskelstränge zusammen, um Wasser aus dem vom Quallenkörper umschlossenen Bereich nach außen wegzustoßen und so vorwärts zu schwimmen. Dafür wird der Muskelring elektrisch aktiviert. Dies geschieht durch den Nervenring, in welchem sich die elektrische Aktivität zunächst ausbreitet und dann die angekoppelten Muskelzellen anregt.
Doch wie spielen Nerven- und Muskelzellen zusammen, um das notwendige Tempo bei der Muskelkontraktion zu erzielen? „Im denkbar einfachsten Fall würde sich die elektrische Erregung in eine Richtung einmal im Kreis über den gesamten Ring ausbreiten“, sagt Susanne Schreiber, Leiterin der Arbeitsgruppe. „Doch dann würde die Kontraktion zu lange dauern, die Qualle würde ins Taumeln geraten.“ Selbst wenn sich die elektrische Aktivität vom Stimulationspunkt aus in zwei Richtungen gleichzeitig bewegen und damit die Zeitspanne bis zur Aktivierung der Muskeln halbieren würde, das zeigten die Simulationen, sei das nicht ausreichend, um die Schwimmbewegungen zu stabilisieren.
Eleganter Erregungs-Mechanismus ermöglicht rasche Muskelkontraktion
Die Forschenden decken in ihrer Studie auf, dass Quallen ein elegantes Prinzip nutzen, um die Zeitspanne der Muskelkontraktion deutlich zu reduzieren: Die elektrische Erregung breitet sich vom Stimulationspunkt im Nervenring zunächst in zwei Richtungen aus. Anfangs ist diese Aktivität der Nervenzellen noch zu schwach, um die Muskeln zu stimulieren. Erst im Laufe der Ausbreitung synchronisieren sich die elektrischen Signale im Nervenring und reichen dann erst aus, um die Muskelzellen „zu zünden“. In der Folge breiten sich nun vier Aktivitätswellen im Muskelring aus (von beiden Zündpunkten aus in beide Richtungen). Damit reduziert sich die gesamte Zeitspanne bis alle Muskeln im Ring aktiviert werden auf etwa ein Viertel. Außerdem ist die Muskelaktivierung symmetrischer, was eine geradlinigere Bewegung ermöglicht.
„Die Simulation der Schwimmbewegung der Qualle belegt, dass nur bei einer Nervenzell-Muskel-Kopplung, die dieses vierfache Ausbreitungsprinzip unterstützt, die Schwimmbewegung stabil möglich ist“, sagt Schreiber. Die Studie zeige außerdem, wie wichtig es ist, den direkten Zusammenhang zwischen den Eigenschaften der einzelnen Nervenzellen, den Muskelzellen und dem Verhalten des Tieres in seiner natürlichen Umgebung zu berücksichtigen. „Bei Tieren mit weniger komplexen Nervensystemen wie der Qualle ist dies dank mathematischer Simulation nun möglich und so können Mechanismen entdeckt werden, mittels derer Nervenzellen mit ihren Eigenschaften eine direkte Auswirkung auf das Verhalten haben.“
Originalpublikation:
https://www.jneurosci.org/content/45/20/e1370242025
02.07.2025, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns
Zwei Seiten desselben Fossils: die Geschichte einer kleinen baum-bewohnenden Echse aus der Jurazeit
SNSB und LMU Paläontologen identifizieren eine neue urtümliche Echse aus den Solnhofener Plattenkalken. Möglich wurde die Beschreibung durch einen Zufallsfund: Erst kürzlich fand ein Doktorand die Gegenplatte des Original-Fossils im Naturhistorischen Museum in London. Ihre Ergebnisse veröffentlichte die Forscher in der Fachzeitschrift Zoological Journal of the Linnean Society.
Das Echsen-Fossil ist eigentlich schon seit den 1930er Jahren bekannt: Die Solnhofener Kalkplatte aus dem Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt zeigt den Körperabdruck eines kleinen, langgliedrigen Reptils, 150 Millionen Jahre alt. Das Tier ähnelt heutigen Eidechsen sowie der neuseeländischen Brückenechse und wurde bislang für ein Exemplar der fossilen Brüchenechsen-Art Homoeosaurus maximiliani gehalten. Neue Erkenntnisse lieferte nun ein Zufallsfund: Im Naturhistorischen Museum in London stieß Victor Beccari, Doktorand an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie sowie der LMU München auf ein Skelett, das dem beschriebenen Frankfurter Exemplar sehr ähnlich war. Tatsächlich handelte es sich um die Gegenplatte des Senckenberg-Fossils, welche die meisten Knochen dieses urzeitlichen Reptils enthielt.
Das neue Exemplar lieferte wichtige Informationen zum Verständnis der Biologie der ursprünglichen Reptilien und stellt eine ganz neue Art dar, Sphenodraco scandentis. Die Ergebnisse der Studie veröffentlichte Victor Beccari nun gemeinsam mit einem internationalen Team von Experten, darunter auch der SNSB-Paläontologe Prof. Oliver Rauhut, Experte für die Reptilien aus Solnhofen.
Die Plattenkalke aus dem Altmühltal zwischen Solnhofen und Kelheim sind weltberühmt für ihre vielen ausgezeichnet erhaltenen Fossilien, darunter auch der Urvogel Archaeopteryx. Das liegt auch an der ganz besonderen Art der Erhaltung: Die Fossilien aus dieser Fundstelle sind flach in Kalkschichten eingebettet. Spaltet der Fossiliensammler die Kalkplatte, so findet sich meist ein Teil des Skeletts in der einen Hälfte und der Körperabdruck in der anderen Hälfte. In der Regel werden Platte und Gegenplatte zusammen aufbewahrt.
„Offenbar wurden die beide Teile dieses Fossils vor fast einem Jahrhundert getrennt voneinander an die Museen in Frankfurt und London verkauft, wo sie bis heute zu sehen sind. Die Verbindung zwischen den beiden Platten ging allerdings verloren. Bis jetzt war uns Wissenschaftlern nur die Frankfurter Plattenhälfte bekannt“, sagt Victor Beccari, Erstautor der Studie.
Heute kennt man nur noch eine einzige lebende Art der Eidechsen-ähnlichen Rhynchocephalia: die Brückenechse aus Neuseeland. Zur Zeit der Trias und des Jura waren Rhynchocephalia weit verbreitet und kamen neben den Dinosauriern auf fast allen Kontinenten vor. „Das Solnhofener Archipel ist bekannt für seine artenreiche Rhynchocephalia-Fauna. Vor dort kennen wir Hunderte gut erhaltener, fast vollständiger Skelette dieser Echsengruppe. Jedes neue Fossil liefert uns mehr Erkenntnisse über ihre Evolution und Lebensweise, so auch Sphenodraco scandentis“, sagt Victor Beccari. So zeigt das nun vollständige Fossil aus Frankfurt und London Merkmale, die sich von bisher gefundenen Rhynchocephalia unter-scheiden: Die Echse hat im Verhältnis zu ihrer geringen Körpergröße beispielsweise stark verlängerte Gliedmaßenknochen. Ein Vergleich mit der Lebensweise heutiger Eidechsen mit ähnlichem Körperbau zeigt: Vermutlich war das Tier ein guter Kletterer und hat auf Bäumen gelebt, vielleicht war es sogar der erste Baumbewohner aus der Gruppe der Rhynchocephalia, so die Forschenden.
Originalpublikation:
Victor Beccari, Alexandre R D Guillaume, Marc E H Jones, Andrea Villa, Natalie Cooper, Sophie Regnault, Oliver W M Rauhut, An arboreal rhynchocephalian from the Late Jurassic of Germany, and the importance of the appendicular skeleton for ecomorphology in lepidosaurs, Zoological Journal of the Linnean Society, Volume 204, Issue 3, July 2025, zlaf073, https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaf073
03.07.2025, Veterinärmedizinische Universität Wien
Feuersalamander: Die Struktur des Lebensraumes beeinflusst das Risiko von Prädation
Der in Österreich heimische Feuersalamander wehrt sich gleich doppelt gegen Raubtiere: Durch seine auffällige Warnfärbung und durch ein weißliches, giftiges Sekret, das er aus Drüsen auf seinem Rücken absondern kann. Die Warnfärbung ist unterschiedlich auffällig – was laut einer soeben veröffentlichten Studie des Konrad-Lorenz-Instituts für Vergleichende Verhaltensforschung (KLIVV) der Veterinärmedizinischen Universität Wien die Salamander vor Fressfeinden nur bedingt schützt. Was jedoch einen wirksamen zusätzlichen Schutz bieten würde, sind nicht-bewirtschaftete Waldgebiete.
Raubtier-Beute-Interaktionen sind eine Art evolutionäres Wettrüsten – beeinflusst von Umweltfaktoren. Eine verbreitete Strategie zur Abwehr von Raubtieren ist der so genannte Aposematismus. Dabei handelt es sich um eine Kopplung von Warnsignalen (beispielsweise optischen) mit sekundären (z. B. chemischen) Abwehrmechanismen zur Abschreckung. Der Europäische Feuersalamander (Salamandra salamandra) ist eine solche aposematische Amphibie. „Ihre ausgeprägte gelb-schwarze Warnfärbung sowie Hautgifte schützen sie vor Fressfeinden, wobei der Gelbanteil auf ihrem Rücken negativ mit Fressversuchen korreliert. Je gelber sie sind, desto besser sind sie also geschützt“, erklärt Carolin Dittrich, eine der Hauptautorinnen diese Studie.
Effektiver Schutz durch nicht bewirtschaftete Waldgebiete
Ein wichtiger Lebensraum des Feuersalamanders ist der Biosphärenpark Wienerwald, eine Waldregion, in der sowohl Schutzgebiete als auch Gebiete mit Waldbewirtschaftung zu finden sind. In diesem natürlichen Habitat verglichen die Forscher:innen die Prädationsraten der Feuersalamander. Die dazu verwendeten Salamander Modelle aus Knetmasse hatten zwar die gleiche Menge an gelber Rückenfärbung, unterschieden sich jedoch darin, dass ihre Gelbfärbung entweder über viele kleine oder wenige große Markierungen verteilt war und sie entweder in geschützten oder bewirtschafteten Zonen platziert wurden. „Wir beobachteten keine Unterschiede aufgrund der Größe der Markierungen, da alle Modelle ähnlich oft angegriffen wurden. Allerdings waren die Angriffe durch Vögel in bewirtschafteten Waldgebieten häufiger als in geschützten Gebieten,“ so Bibiana Rojas (KLIVV) zu den Ergebnissen.
Komplexität der Waldstruktur und Baumvielfalt machen den Unterschied
Die Hauptunterschiede zwischen diesen Waldzonen betrafen die Baumvielfalt. „Wir vermuten, dass die Waldstruktur und -komplexität zu Unterschieden in der Häufigkeit oder der Zusammensetzung der Raubtiergemeinschaften führen kann, was wiederum die Angriffsraten beeinflussen könnte“, erklärt Rojas. Die Studienautorin betont deshalb die Bedeutung von Schutzgebieten als potenzielle Zufluchtsorte für Feuersalamander und sieht einen großen Bedarf für weitere Forschungsarbeiten, „speziell, um die Auswirkungen von Unterschieden in der Zusammensetzung von Raubtiergemeinschaften auf das Prädationsrisiko in verschiedenen Waldgebieten zu untersuchen. Außerdem verdeutlicht unsere Studie die komplizierten Beziehungen zwischen evolutionären Strategien, ökologischen Interaktionen und menschlicher Landnutzung. Und sie unterstreicht die Notwendigkeit eines integrierten Ansatzes für die Waldbewirtschaftung, der das komplexe Gleichgewicht natürlicher Ökosysteme berücksichtigt.“
Originalpublikation:
Der Artikel „Habitat alteration impacts predation risk in an aposematic amphibian“ von Doriane Hagnier, Carolin Dittrich, Myrna Van den Bos und Bibiana Rojas wurde im „Journal of Zoology“ veröffentlicht.
https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jzo.70036
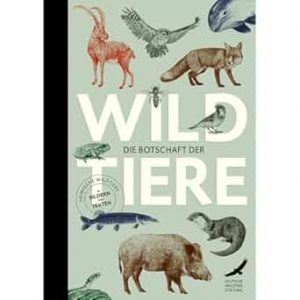 04.07.2025, Deutsche Wildtier Stiftung
04.07.2025, Deutsche Wildtier Stiftung
Buchtipp: Die Botschaft der Wildtiere
300 Seiten geballtes Wissen über Fuchs und Hase, Wald und Weide
In Deutschland leben rund 48.000 Wildtierarten. Viele davon trifft man buchstäblich vor der eigenen Haustür. Insekten und Käfer beispielsweise, Singvögel und Fledermäuse, manchmal auch Reh, Fuchs, Igel oder Wildschwein. Wie wohnen diese Tiere, was fressen sie? Wie haben sie ihre Fortbewegung an ihre Lebensräume an Land, im Wasser, in der Luft oder unter der Erde angepasst? Welche Sinne setzen sie wie ein? Wie finden sie ihre Partner und wer kümmert sich um den Nachwuchs? Wer ist ein Einzelgänger, wer ein Familientier? Wer hinterlässt welche Spuren? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt das neue Sachbuch „Die Botschaft der Wildtiere“.
Die knapp 300 Seiten sind ein Spaziergang durch die gleichnamige Ausstellung der Deutschen Wildtier Stiftung in der Hamburger HafenCity. Mit zahlreichen Fotos, anschaulichen Grafiken, liebevollen Illustrationen und verständlichen Texten geht es auf eine Reise in die Welt der heimischen Tiere. Der erste Teil beschreibt ihr Leben und ihre erstaunlichen Anpassungen und Besonderheiten. Der zweite Teil widmet sich dem manchmal komplizierten und konfliktreichen Zusammenleben von Mensch und Wildtier – in der Stadt, im Wald und auf Wiesen, Weiden und Feldern, im Meer und an der Küste. Und er bietet Denkanstöße und Lösungsansätze für die wichtige Frage: Was können wir tun, um unsere wilden Nachbarn zu schützen?
Die Botschaft der Wildtiere (AffiliateLink)
Lebensweisen und Lebenswelten der heimischen Wildtiere
ISBN 978-3-96849-131-8
28 Euro.


