09.05.2019, Universität Basel
Neuartige Form des Sehens bei Tiefseefischen entdeckt
In der Tiefsee leben Fische, die in fast absoluter Dunkelheit Licht verschiedener Wellenlängen sehen können. Im Gegensatz zu anderen Wirbeltieren besitzen sie nämlich mehrere Gene für das lichtempfindliche Sehpigment Rhodopsin. Damit sind die Fische in der Lage, unterschiedliche Lichtsignale von Leuchtorganen wahrzunehmen, wie ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Evolutionsbiologen der Universität Basel in der Zeitschrift «Science» berichtet.
Das Farbensehen kommt bei den Wirbeltieren normalerweise durch das Zusammenspiel von unterschiedlichen Sehpigmenten in den Zapfenzellen der Netzhaut zustande. Diese Zellen reagieren jeweils auf eine bestimmte Wellenlänge des Lichts, beim Menschen etwa auf dessen roten, grünen und blauen Anteil. Doch funktioniert die Farbwahrnehmung nur bei Tageslicht – bei Dunkelheit können Wirbeltiere die wenigen Lichtteilchen nur mittels der lichtempfindlichen Stäbchenzellen erkennen. Diese enthalten nur eine einzige Form des Sehpigments Rhodopsin – dies ist der Grund, weshalb die allermeisten Wirbeltiere in der Nacht farbenblind sind.
Silberkopf mit Gen-Rekord
Ein internationales Forschungsteam um Prof. Dr. Walter Salzburger von der Universität Basel hat nun mehr als 100 Genome von Fischen analysiert, darunter vielen, die in der Tiefsee leben. Die Zoologen fanden heraus, dass bestimme Tiefseefische ihr Repertoire an Rhodopsin-Genen vervielfältigt haben. Besonders sticht dabei der Silberkopf (Diretmus argenteus) heraus, der nicht weniger als 38 Kopien des Rhodopsin-Gens besitzt, zusätzlich zu zwei weiteren Opsinen eines anderen Typs. «Damit ist der im Dunkeln lebende Silberkopf das Wirbeltier mit den am Abstand meisten Genen für Sehpigmente», so Salzburger.
Die vielen unterschiedlichen Rhodopsin-Genkopien der Tiefseefische sind jeweils auf die Wahrnehmung einer bestimmten Wellenlänge des Lichts angepasst, berichten die Forscher weiter. Zeigen liess sich dies durch Computersimulationen und funktionelle Experimente an Rhodopsin-Proteinen, die im Labor hergestellt wurden. Dabei decken die Gene genau den Wellenlängenbereich des durch Leuchtorgane «hergestellten» Lichts ab, der sogenannten Biolumineszenz. Als Biolumineszenz wird die Fähigkeit von Lebewesen bezeichnet, selbst oder mithilfe von andern Organismen Licht zu erzeugen. So lockt etwa der Anglerfisch mit seinen Leuchtorganen Beutefische an.
Signale im Dunkeln erkennen
Die Tiefsee ist der grösste belebte Lebensraum der Erde und gleichzeitig wegen seiner Unzugänglichkeit einer der am wenigsten erforschten. Viele Organismen haben sich an das Leben in dieser unwirtlichen Umwelt und in fast vollständiger Dunkelheit angepasst. Beispielsweise haben viele Fische hoch empfindliche Teleskop-Augen entwickelt, um das minimale Restlicht in den Tiefen der Ozeane wahrnehmen zu können.
Bei Wirbeltieren sind im Protein für Rhodopsin 27 Schlüsselpositionen bekannt, die einen direkten Einfluss darauf haben, welche Lichtwellenlänge wahrgenommen wird. In den verschiedenen Gen-Kopien der Silberköpfe in der Tiefsee waren allein 24 dieser Positionen durch Mutationen verändert, fanden die Forscher.
«Es scheint, als ob Tiefseefische mehrmals unabhängig voneinander diese auf vielen Rhodopsin-Kopien basierte Form des Sehens entwickelt haben, ebenso dass dies speziell dem Erkennen von Signalen der Biolumineszenz dient», sagt Salzburger. Dies könnte den Tiefseefischen einen evolutionären Vorteil verschafft haben, indem sie potenzielle Beute oder Fressfeinde sehr viel besser sehen können.
«In jedem Fall helfen unsere Ergebnisse, das gängige Paradigma in Bezug auf die Rolle von Stäbchen- und Zapfenzellen bei der Farbwahrnehmung zu verfeinern», schreiben die Zoologen. Einmal mehr zeigt sich, dass die Analyse von ganzen Genomen zu neuen Erkenntnissen in der Biologie führen kann.
Originalpublikation:
Zuzana Musilova, Fabio Cortesi, Michael Matschiner, Wayne I. L. Davies, Jagdish Suresh Patel, Sara M. Stieb, Fanny de Busserolles, Martin Malmstrøm, Ole K. Tørresen, Celeste J. Brown, Jessica K. Mountford, Reinhold Hanel, Deborah L. Stenkamp, Kjetill S. Jakobsen, Karen L. Carleton, Sissel Jentoft, Justin Marshall, Walter Salzburger
Vision using multiple distinct rod opsins in deep-sea fishes
Science (2019), doi: 10.1126/science.aav4632
https://science.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.aav4632
13.05.2019, Universität Stuttgart
Universität Stuttgart benennt neue Bärtierchen-Art: Milnesium inceptum entdeckt
Eine neue Bärtierchen-Art wurde von Dr. Ralph Schill vom Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme der Universität Stuttgart entdeckt. Es handelt sich um die nun als Milnesium inceptum bezeichnete Bärtierchenart, abgeleitet von dem lateinischen Begriff für Pionier oder Initiator. Gleichzeitig klassifizierte Schill zusammen mit Kollegen aus England, Polen und Japan eine andere Bärtierchenart, Milnesium alpigenum, die bereits Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieben, aber nicht mehr als Präparat vorhanden war, neu als Neotyp.
Bärtierchen sind Überlebenskünstler. Sie kommen in unterschiedlichsten Lebensräumen vor und haben die Fähigkeit, lange Zeiten in einem Überdauerungsstadium auf bessere Umweltbedingungen zu warten, ohne dass ein Stoffwechsel nachweisbar ist. Deshalb interessiert sich eine stetig wachsende Zahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für diese faszinierenden Tiere.
Eine der ersten Arten überhaupt, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschrieben wurde, ist die Art Milnesium tardigradum, der der französische Zoologe Louis Michel François Doyère seinen Namen gab. 13 Jahre später beschrieb der deutsche Zoologe Christian Gottfried Ehrenberg mit der Milnesium alpigenum eine weitere Art, die im Monte Rosa Gebirgsmassiv in den Walliser Alpen an der Grenze zwi¬schen Italien und der Schweiz erstmals gefunden wurde. Mit einer eigenen, im Naturpark Schönbuch gefundenen Bärtierchenart „Milnesium tardigradum Doyère 1840“ zugeordneten Tierkultur kam 2003 der Zoologe Ralph Schill an die Universität Stuttgart. Mit dieser von ihm dann als Modellorganismus etablierten Art schuf er eine der renommiertesten Bärtierchenforschergruppen weltweit. Zwischen 2003 und 2016 entstanden darüber über 30 wissenschaftliche Publikationen. Das weltweit größte Bärtierchenprojekt „FUNCRYPTA“ wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
Wissenschaftler bestimmen neue Art
Ausschlaggebend für eine Artbeschreibung ist der Vergleich mit dem sogenannten Holotyp, dem Tier, dass zur erstmaligen Beschreibung verwendet wurde. Nachdem sowohl die Präparate von Doyère als auch Ehrenberg nicht mehr erhalten sind, wurden so genannte Neotypten definiert, Präparate, die stattdessen die jeweilige Art repräsentieren und als Vergleichsmaterial dienen. Zu den dafür bislang verwendeten morphologischen Merkmalen kommen inzwischen noch molekulare Informationen wie DNA-Sequenzen hinzu. Beim Vergleich vieler Exemplare von der Art Milnesium tardigradum aus verschiedenen Regionen der Welt stellten Zoologen fest, dass sowohl die Stuttgarter Art als auch die eines japanischen Wissenschaftlers zu einer neuen Art gehören müssen. Daraufhin wurde eine Milnesium-Art als neuen Neotyp der nicht mehr vorhandenen Art Milnesium alpigenum neu beschrieben und die Stuttgarter Bärtierchen als neue Art Milnesium inceptum in die Wissenschaft eingeführt. Der Name der neuen Art stammt vom lateinischen „inceptor“, was „ein Initiator“ oder „ein Pionier“ bedeutet, nachdem Ralph Schill diese Art zum neuen Mo-dellorganisms in der Bärtierchenforschung etabliert hatte.
Neues Standardwerk über die kleinen Wasserbären erschienen
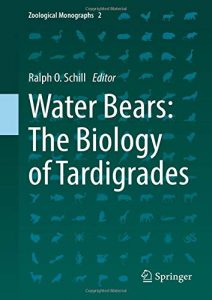 In Zusammenarbeit mit 25 führenden Bärtierchenforschern und heraus-gegeben von Schill ist jetzt ein Standardwerk „Water Bears: The Biology of Tardigrades“ erschienen. Es enthält erstmals eine vollständige Be¬schreibung der ersten knapp zweihundert Jahre Bärtierchenforschung. Das über 400 Seiten umfassende Buch mit 51 Schwarz-Weiß-Illustrationen und 65 farbigen Abbildungen dokumentiert die Entdeckung der Tiere und die erste Beschreibung 1773 bis hin zum aktuelle Stand des Wissens über die Morphologie, Taxono¬mie, Phylogenie, Biogeographie, Paläontologie, Zytologie und Zytogenetik der Bärtierchen. Das Buch gibt Einblicke in die Ökologie der Bärtierchen, die im Meer, in Seen und Flüssen und terrestrischen Lebens¬räumen vorkommen können. Weitere Kapitel enthalten einen Überblick über die Fortpflanzung, Entwicklungs- und Lebenszyklen sowie die außergewöhnlichen Umweltanpassungen wie unter anderem der Trocken- und Gefriertoleranz, für die die Tiere bekannt sind. Auch neueste molekulare Techniken, die in der Bärtierchenforschung angewandt werden, sowie praktische Tipps für die Probenahme und Proben-verarbeitung sind beschrieben. Das Buch schließt mit einem vollständi-gen Überblick über die bisher bekannten Bärtierchengruppen.
In Zusammenarbeit mit 25 führenden Bärtierchenforschern und heraus-gegeben von Schill ist jetzt ein Standardwerk „Water Bears: The Biology of Tardigrades“ erschienen. Es enthält erstmals eine vollständige Be¬schreibung der ersten knapp zweihundert Jahre Bärtierchenforschung. Das über 400 Seiten umfassende Buch mit 51 Schwarz-Weiß-Illustrationen und 65 farbigen Abbildungen dokumentiert die Entdeckung der Tiere und die erste Beschreibung 1773 bis hin zum aktuelle Stand des Wissens über die Morphologie, Taxono¬mie, Phylogenie, Biogeographie, Paläontologie, Zytologie und Zytogenetik der Bärtierchen. Das Buch gibt Einblicke in die Ökologie der Bärtierchen, die im Meer, in Seen und Flüssen und terrestrischen Lebens¬räumen vorkommen können. Weitere Kapitel enthalten einen Überblick über die Fortpflanzung, Entwicklungs- und Lebenszyklen sowie die außergewöhnlichen Umweltanpassungen wie unter anderem der Trocken- und Gefriertoleranz, für die die Tiere bekannt sind. Auch neueste molekulare Techniken, die in der Bärtierchenforschung angewandt werden, sowie praktische Tipps für die Probenahme und Proben-verarbeitung sind beschrieben. Das Buch schließt mit einem vollständi-gen Überblick über die bisher bekannten Bärtierchengruppen.
Originalpublikation:
W. Morek et. al 2019. Redescription of Milnesium alpigenum Ehrenberg, 1853 (Tardigrada: Apochela) and a description of Milnesium inceptum sp. nov., a tardigrade laboratory model. Zootaxa 4586 (1): 035–064
https://doi.org/10.11646/zootaxa.4586.1.2 (open access)
„Water Bears: The Biology of Tardigrades“, Springer Verlag, 2018
419 Seiten, 118 Illustrationen, ISBN 978-3-319-95702-9
13.05.2019, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)
Anglerinnen und Angler sorgen für Fischartenvielfalt im Baggersee
Forschende des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) haben zusammen mit Fischereibiologen des Anglerverbands Niedersachsen (AVN) die Fischgemeinschaften in anglerisch bewirtschafteten und unbewirtschafteten Baggerseen verglichen. Die von Freizeitanglerinnen und -anglern bewirtschafteten Seen zeichneten sich durch eine höhere natürliche Artenvielfalt aus als Baggerseen ohne fischereiliche Bewirtschaftung. Nicht-heimische Fischarten kamen in beiden Seentypen hingegen nur sporadisch vor.
Baggerseen sind vom Menschen geschaffene Ökosysteme. Sie werden in der Regel durch das Grundwasser gespeist. Fehlt eine Verbindung zu benachbarten natürlichen Gewässern wie Flüssen, werden sie nur langsam von Fischen besiedelt.
Forschende des IGB und Vertreter des AVN haben in einem von Bundesforschungs- und Bundesumweltministerium sowie dem Bundesamt für Naturschutz geförderten Projekt die Fischgemeinschaften anglerisch bewirtschafteter und unbewirtschafteter Baggerseen in Niedersachsen miteinander verglichen. Das überraschende Ergebnis: Von Anglern bewirtschaftete, künstlich entstandene Seen weisen im Vergleich zu unbewirtschafteten Baggerseen eine deutlich höhere natürliche Fischartenvielfalt auf. In den untersuchten bewirtschafteten Baggerseen kamen in der Regel neun bis elf verschiedene Fischarten vor, in den unbewirtschafteten rund drei bis fünf. IGB-Fischereibiologe Sven Matern erläutert: „Angler werden von manchen Naturschützern als Störfaktor an Gewässern angesehen. Unsere Erhebungen zeigen jedoch, dass Freizeitfischer vor allem als Heger von Gewässern wirken, indem sie helfen, artenreiche Fischgemeinschaften in Baggerseen zu etablieren, die denen von natürlichen Seen sehr stark ähneln.“
Die Forschenden fanden außerdem heraus, dass insbesondere anglerisch begehrte heimische und teilweise bedrohte Raubfische wie Hecht, Barsch und Aal häufiger in den bewirtschafteten Baggerseen anzutreffen sind. Unbewirtschaftete Seen werden vor allem von Kleinfischen wie Moderlieschen oder Stichlingen besiedelt. Die oft gefürchteten invasiven und nicht-heimischen Fischarten wie Graskarpfen oder Forellenbarsche konnten die Forschenden in den untersuchten Baggerseen hingegen kaum nachweisen, egal ob bewirtschaftet oder nicht. Allerdings wurden überraschenderweise in einem nicht-bewirtschafteten Baggersee Goldvarianten von Rotfedern nachgewiesen; Fische, die typischerweise in Gartenteichen vorkommen und wohl von Privatpersonen illegal in den Baggersee ausgesetzt wurden.
„Die Ergebnisse sind ein Beleg, dass die anglerische Bewirtschaftung zur Etablierung natürlicher Fischgemeinschaften in Baggerseen beiträgt, nicht hingegen zur Verbreitung nicht-heimischer Arten und auch nicht zur Ausbildung naturferner Fischgemeinschaften. Auch zeigte sich, dass der Baggersee um die Ecke für eine Vielzahl von Fischarten ein geeigneter Lebensraum ist, der dem Rückgang der biologischen Vielfalt ein Stück weit Einhalt gebieten kann“, resümiert Projektleiter Prof. Dr. Robert Arlinghaus vom IGB und der Humboldt-Universität zu Berlin.
Originalpublikation:
Matern, S., Emmrich, M., Klefoth, T., Wolter, C., Nikolaus, R., Wegener, N., R. Arlinghaus. Effect of recreational-fisheries management on fish biodiversity in gravel pit lakes, with contrasts to unmanaged lakes. Journal of Fish Biology, https://doi.org/10.1111/jfb.13989
14.05.2019, Gruner + Jahr, GEO
Artenvielfalt in Deutschland: GEO-Tag der Natur e.V. ruft unter dem Leitmotiv „Essen, was schützt“ zum Mitmachen auf
Am 15. und 16. Juni 2019 findet der diesjährige GEO-Tag der Natur mit über hundert Aktionen in ganz Deutschland statt. Getreu dem Kernversprechen „Unsere Natur mit anderen Augen sehen“ vermitteln die Aktionstage neue Perspektiven auf die Natur und Umwelt. In diesem Jahr steht der GEO-Tag der Natur unter dem Leitmotiv „Essen, was schützt“ und geht einigen zentralen Fragen auf den Grund: Wie lassen sich Landwirtschaft, Lebensmittelkonsum und Artenschutz in Einklang bringen? Wie können Verbraucher durch ihre Kaufentscheidungen zum Artenschutz beitragen?
Der GEO-Tag der Natur ist eine der größten Veranstaltungen zur Feldforschung der Artenvielfalt in Europa. Forscher und Naturinteressierte zählen und dokumentieren am Aktionswochenende, welche Tier- und Pflanzenarten in Wäldern, Feldern und an Flussufern, aber auch in Metropolregionen, Städten und Gemeinden leben. Dabei können Naturinteressierte den Arten-ExpertInnen über die Schulter schauen und in Vorträgen und Exkursionen die heimische Natur neu entdecken. Mit der Aktion möchte der GEO-Tag der Natur e.V. auf die Artenvielfalt vor unserer Haustür aufmerksam machen und die Menschen für deren Schutz und Erhalt sensibilisieren.
Die diesjährige Hauptveranstaltung mit Vorträgen und Workshops findet auf dem Hof vom Ökodorf Brodowin in Berlin-Brandenburg statt. Den Auftakt bildet zuvor am Abend des 14. Juni eine Podiumsdiskussion zum Leitmotiv „Essen, was schützt“ in der Bertelsmann-Repräsentanz Unter den Linden 1 in Berlin. GEO-Chefredakteur Christoph Kucklick diskutiert u.a. mit Staatssekretärin im Bundesumweltministerium Rita Schwarzelühr-Sutter, Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben, Leiter Naturschutz bei der Heinz Sielmann Stiftung Dr. Hannes Petrischak sowie Andreas Gehlhaar, Leiter des Umweltbereichs der Deutschen Bahn, über die Aspekte nachhaltigen Konsums.
Alle Informationen, Angebote und die Möglichkeit zur Anmeldung eigener Veranstaltungen gibt es unter www.geo-tagdernatur.de
In Hamburg findet der GEO-Tag der Natur in Kooperation mit dem Centrum für Naturkunde (CeNak) der Universität Hamburg im Rahmen des Langen Tags der StadtNatur der Loki Schmidt Stiftung statt. Viele der Aktionen und Artenerfassungen finden im Naturschutzgebiet Diekbek im Hamburger Stadtteil Duvenstedt statt. Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter: tagderstadtnaturhamburg.de
Hauptförderer des GEO-Tags der Natur ist die Heinz Sielmann Stiftung, die sich seit 1994 für den Schutz der Lebensräume bedrohter Tier- und Pflanzenarten einsetzt und die Aufklärung über die Bedeutung der Biodiversität vorantreibt.
Die diesjährigen Partner des GEO Tags der Natur e.V. sind: Hamburg: Langer Tag der StadtNatur der Loki Schmidt Stiftung; Centrum für Naturkunde (CeNak) der Universität Hamburg; Metropolregion Hamburg Brodowin und Berlin: Ökodorf Brodowin, Bertelsmann SE & Co. KGaA
14.05.2019, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei
Geschlechtsreife Aale bauen ihre Knochen ab
Um zu ihren Fortpflanzungsgebieten zu gelangen, schwimmen Europäische Aale mehrere Tausend Kilometer auf die andere Seite des Atlantiks. Wie ein internationales Forscherteam jetzt herausfand, verändert sich dabei ihr Körper auf dramatische Weise. Die Knochen bilden sich zurück und es werden toxische Schwermetalle frei, die für die bedrohte Art zum Problem werden könnten.
Der Europäische Aal (Anguilla anguilla) ist eine Fischart mit außergewöhnlicher Fortpflanzungsstrategie. Er wächst über Jahre in europäischen Flüssen, Seen und Küstengewässern heran und begibt sich mit beginnender Geschlechtsreife auf eine mehrere Tausend Kilometer lange Reise, die ihn quer über den Atlantik in die Sargassosee führt. Dort angekommen, laicht er ab und stirbt. Wissenschaftler des Thünen-Instituts für Fischereiökologie in Bremerhaven, der RWTH Aachen, der belgischen Universität Ghent sowie der kanadischen Universität Saskatchewan haben jetzt untersucht, wie die Tiere ihren Körper während der Reifung umstrukturieren. Dabei fanden sie heraus, dass neben Mineralien, die in den Knochen und Muskeln gespeichert sind, auch toxisch wirkende Schwermetalle in die sich entwickelnden Eier übertragen werden. In ihrer Studie diskutieren die Forscher nun, welche Konsequenzen dies für die bedrohte Art haben könnte.
Mit Beginn des Reifungsprozesses, dem sogenannten Blankwerden, ändert sich die Färbung der Aale von hellgelb zu schimmerndem Silber. Die Aale stellen die Nahrungsaufnahme ein und ihr Verdauungstrakt bildet sich zurück. Doch damit nicht genug: Das interdisziplinäre Wissenschafter-Team zeigte anhand verschiedener bildgebender Verfahren (Computertomographie, MRT), wie Aale während ihres Reifungsprozesses ihr Skelett als Mineralstoffquelle nutzen, um ihre Gonaden (Geschlechtsorgane) aufzubauen. Der Mineraliengehalt und die Masse der Knochen nehmen im Laufe der Reifung so stark ab, dass dies auch Auswirkungen auf die mechanische Stabilität der Wirbel haben kann. Die beobachteten Vorgänge sind bei Weibchen deutlich stärker ausgeprägt als bei Männchen.
Ein ähnlicher Vorgang – allerdings als Krankheit – ist bei Menschen als Osteoporose oder Knochenschwund bekannt; auch hier sind häufiger Frauen als Männer betroffen. Jedoch anders als beim Menschen geht beim Aal die Abnahme von Phosphor und Calcium in Knochen mit der Zunahme dieser Elemente in den Weichgeweben wie Gonaden und Muskeln einher. Die Forscher erklären das damit, dass die Aale sich angeeignet haben, ihre Knochen und Muskeln als Energie- und Mineralspeicher für Wanderung und Fortpflanzung zu nutzen.
In ihren Untersuchungen entdeckten die Wissenschaftler zudem, dass eine Reihe von potenziell giftigen Metallen wie Cadmium, Kupfer, Mangan und Quecksilber von Muskeln, Leber oder Knochen in die Eierstöcke der weiblichen Blankaale übertragen werden. „Da der Bestand der Aale in den letzten Jahrzehnten sehr stark zurückgegangen ist und die Art mittlerweile als vom Aussterben bedroht gilt, kommt diesem Befund eine besondere Bedeutung zu“, sagt Marko Freese vom Thünen-Institut. „Es ist bekannt, dass diese Metalle freie Radikale erzeugen, die toxisch wirken können“, so Dr. Larissa Rizzo vom Uniklinikum der RWTH Aachen. Dr. Markus Brinkmann von der kanadischen Universität Saskatchewan ergänzt: „Schwermetalle, die die Aale in ihren kontinentalen Lebensräumen aufnehmen und die dann vom Mutterfisch auf die Eier übergehen, könnten den Fortpflanzungserfolg der Aale beeinträchtigen und somit ein Faktor für den beobachteten Rückgang der Population sein.“ Zusätzlich machen Flussverbauungen, Fischerei und Parasiten dem Europäischen Aal das Überleben schwer.
Die molekularen Prozesse, die mit dem dramatischen Körperumbau während der Wanderung und Reifung einhergehen, waren in dieser Tiefe bislang nicht bekannt. Ihre Ergebnisse haben die Forscher in der renommierten amerikanischen Fachzeitschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) veröffentlicht.
Originalpublikation:
Freese et al. (2019): Bone resorption and body reorganization during maturation induce maternal transfer of toxic metals in anguillid eels.
https://doi.org/10.1073/pnas.1817738116
14.05.2019, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns
Archaeopteryx bekommt Gesellschaft
Forscher der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie (SNSB-BSPG) sowie der LMU München beschreiben einen bislang unbekannten Vogel aus dem oberen Jura – es ist erst der zweite bekannte flugfähige Vogel aus dieser Periode überhaupt, neben dem berühmten Archaeopteryx.
Der Thron des Archaeopteryx wackelt. Seit im Jahr 1861 das erste Fossil des Urvogels gefunden wurde, gilt er als einziger Vogel aus der erdgeschichtlichen Periode des Jura. Er belegt als Übergangsform zwischen Reptilien und Vögeln, dass die heutigen Vögel direkte Nachfahren von Raubdinosauriern sind. Alle bislang von ihm gefundenen Exemplare stammen aus dem Gebiet des Solnhofer Archipels, das sich im Jura im Bereich des heutigen Altmühltals erstreckte, in der Gegend zwischen Pappenheim und Regensburg. Hier lebte Archaeopteryx vor etwa 150 Millionen Jahren in einer Riff-Insel-Landschaft. Nun hat ein Team um Prof. Oliver Rauhut einen bislang unbekannten Vogel aus der Gegend taxonomisch beschrieben, es ist der zweite bekannte flugfähige Vogel aus dieser Periode überhaupt: Alcmonavis poeschli. „Das weist darauf hin, dass die Diversität der Vogelwelt im oberen Jura größer war als bislang bekannt“, sagt Rauhut, Paläontologe am Department für Geo- und Umweltwissenschaften der LMU sowie an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie.
Von Alcmonavis poeschli wurde nur ein Flügel entdeckt. „Wir hatten erst angenommen, dass auch dieses Exemplar ein Archaeopteryx ist, und haben es uns bei der Untersuchung nicht leicht gemacht. Es sind Ähnlichkeiten da, aber seine fossilen Reste lassen vermuten, dass es sich um einen etwas höher entwickelten Vogel handelt“. Wie die taxonomische Studie, die aktuell im Fachmagazin eLife veröffentlicht ist, zeigt, war Alcmonavis poeschli nicht nur etwas größer als Archaeopteryx. Er konnte offenbar auch besser fliegen: „Muskelansatzstellen am Flügel deuten auf ein verbessertes Flugvermögen hin“, sagt Rauhut. Alcmonavis poeschli weist mehrere Merkmale auf, die Archaeopteryx nicht hat, stammesgeschichtlich jüngere Vögel aber schon. Diese deuten auf eine bessere Anpassung an den aktiven Flatterflug hin.
Damit bringt Alcmonavis poeschli neuen Schwung in die Debatte, ob der Vogelflug über den Gleitflug entstanden ist. „Seine Anpassungen zeigen, dass die Evolution des Fluges relativ schnell vorangeschritten sein muss“, sagt Dr. Christian Foth von der Université de Fribourg (Schweiz), einer der Koautoren der Studie.
Seinen Namen verdankt der nun erstmals beschriebene Vogel dem alten keltsichen Namen der Altmühl, Alcmona, und seinem Entdecker Roland Pöschl, der die Ausgrabungen im Steinbruch am Schaudiberg bei Mörnsheim leitet. In denselben Plattenkalkablagerungen wurde auch ein weiteres Fossil eines Archaeopteryx entdeckt. Die beiden Urvögel haben also offenbar parallel in der damals subtropischen Lagunenlandschaft Süddeutschlands gelebt.
Originalpublikation:
Rauhut, OMW., Tischlinger, H, Foth, C (2019) A non-archaeopterygid avialan theropod from the Late Jurassic of southern Germany. – eLife
https://doi.org/10.7554/eLife.43789.001
16.05.2019, Technische Universität Dresden
Bettgenosse gesucht: Wer war der erste Wirt der Bettwanzen?
Ein internationales Team von Wissenschaftlern unter der kooperativen Leitung des TUD Biologen Prof. Klaus Reinhardt hat neue Erkenntnisse zur Evolution der Bettwanzen in der renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschrift Current Biology veröffentlicht.
Über fünfzehn Jahre lang scheuten sie kein Abenteuer um Bettwanzenproben auf der ganzen Welt zu sammeln: sie mussten in afrikanische Fledermaushöhlen klettern oder steile Vogelfelsen in Südostasien besteigen, um an die kleinen Biester zu gelangen. Doch Aufwand und Mühe haben sich gelohnt: die neue Studie des internationalen Teams von Wissenschaftlern unter der Leitung von Dr. Steffen Roth vom Universitätsmuseum Bergen (Norwegen) und dem Biologen Prof. Klaus Reinhardt von der TU Dresden, zeigt Ergebnisse zur Evolution von Bettwanzen, über welche die Wissenschaftler selbst überrascht waren.
In ihrer Arbeit verglichen sie die DNA von Dutzenden von Bettwanzenarten, um die evolutionären Beziehungen innerhalb der Gruppe sowie ihre Beziehung zu uns Menschen zu verstehen. Das erste verblüffende Ergebnis betrifft das Alter der ungeliebten Blutsauger. Die Studie belegt, dass Bettwanzen vor circa 115 Millionen Jahren entstanden sind. Das bedeutet, dass sie bereits über 30 Millionen Jahre existierten, bevor Fledermäuse entstanden. Bisher hatte man angenommen, dass Fledermäuse die ersten Wirte der Bettwanzen waren. Auch war es „sehr unerwartet zu sehen, dass evolutionär ältere Bettwanzen bereits auf einen einzigen Wirtstyp spezialisiert gewesen sein müssen, obwohl wir leider nicht wissen, wer der Wirt war, er muss ja sogar noch älter als Tyrannosaurus rex gewesen sein“, so Studienleiter Dr. Steffen Roth.
Außerdem fand das Team heraus, dass die beiden Parasiten des Menschen, die gewöhnliche und die tropische Bettwanze, viel älter sind als die Menschen selbst. Dieses Ergebnis widerspricht der gängigen Vorstellung, dass die evolutionäre Aufspaltung des Menschen in Homo erectus und Homo sapiens die Aufspaltung der Bettwanze in zwei neue Arten verursacht hat.
Des Weiteren zeigt die Studie, dass etwa alle halbe Millionen Jahre eine neue Art von Bettwanzen den Menschen erobert. Für Bettwanzen ungewöhnlich, nutzen sie dabei ihre alten Wirte trotzdem weiter. Prof. Klaus Reinhardt prophezeit den Fortgang dieser Entwicklung: „Es wird sicher nicht noch einmal eine halbe Million Jahre dauern, bis die nächste Art der Blutsauger unsere Betten bevölkert, da derzeit viel mehr Menschen auf der Erde leben und der Handel von Tieren und Haustieren viel mehr Möglichkeiten zum Kontakt bieten. In diesem Sinne Gute Nacht und süße Träume.“
Bildunterschrift: Die meisten Bettwanzenarten nutzen Fledermäuse als ihre Wirte. Hier ist eine nordamerikanische Art zu sehen, die Blut aus der Nase einer Fledermaus saugt. Entgegen bisheriger Annahmen, konnten Klaus Reinhardt und sein Team nun beweisen, dass Fledermäuse niht die ersten Wirte der kleinen Blutsauger waren.
Originalpublikation:
Roth, Steffen, Reinhardt, Klaus et al.: „Bedbugs (Cimicidae) Evolved Before Their Bat Hosts and Did Not Co-Speciate with Ancient Humans“ CURRENT-BIOLOGY-D-18-01741R1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.04.048
16.05.2019, Technische Universität Wien
Die Evolution im Darm
Was bestimmt die Zusammensetzung der Mikroorganismen im Verdauungstrakt von Tieren? Eine große Studie der TU Wien und der Karl Landsteiner Universität Krems gemeinsam mit dem MPI Tübingen ging diesem Rätsel nun nach.
Sie sind ein Teil von uns: Wir alle tragen etwa zehnmal so viele Bakterien und Archaeen in uns herum wie eigene Zellen. Das Ökosystem in unserem Verdauungstrakt, das sogenannte Mikrobiom, hat nicht nur für unseren Stoffwechsel eine große Bedeutung, sondern auch für das Immunsystem und sogar das Verhalten. Bei Tieren ist es genauso, allerdings unterscheidet sich die Zusammensetzung des Mikrobioms von Tierart zu Tierart stark.
Erstmals wurde nun eine großangelegte Studie durchgeführt, um anhand von Fäkalproben freilebender Tiere die Entwicklung des Mikrobioms erklären zu können. Untersucht wurden 128 verschiedene Spezies aus den Klassen Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere. So konnte man zeigen, wie Evolution und Ernährungsgewohnheiten zusammenspielen und die Zusammensetzung der Bakterien im Verdauungstrakt bestimmen. Viele Kleinstlebewesen im Darm haben sich über viele Millionen Jahre gemeinsam mit ihren Wirtstieren mitentwickelt. Mit diesem Wissen soll es in Zukunft auch möglich werden, fäkale Verunreinigungen in Gewässern viel genauer bestimmten Tierarten zuzuordnen.
Proben aus allen Ästen des Stammbaums
„Bisher gibt es Untersuchungen am Mikrobiom von Menschen, oder auch spezielle Daten für einzelne Spezies wie etwa Ratten. Wir wollten aber viele Tierarten auswählen, die möglichst repräsentativ den gesamten Stammbaum der Wirbeltiere abdecken – von Vögeln über Säugetiere bis hin zu Fischen“, sagt Prof. Andreas Farnleitner, der an der TU Wien das Interuniversitäre Forschungszentrum „Wasser und Gesundheit“ co-leitet (ICC Water & Health, www.waterandhealth.at) und gleichzeitig als Professor für Mikrobiologische Diagnostik in Erweiterung des ICC Water & Health an der Karl Landsteiner Privatuniversität in Krems forscht.
Wichtig war, Proben von Wildtieren zu bekommen, denn Zootiere können ein ganz anderes Mikrobiom haben als ihre frei lebenden Artgenossen. Bei der Probenbeschaffung war das Institut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien federführender Partner. Dann wurde die DNA der untersuchten Mikroorganismen sequenziert – zum Teil an der TU Wien, zum Teil am Max Planck Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen.
„Insgesamt wurden über 400 Proben von 180 unterschiedlichen Spezies analysiert, dabei wurden 20 Millionen Gen-Sequenzen erhoben“, sagt Dr. Georg Reischer (TU Wien). Die Kooperationspartner des MPI in Tübingen brachten ihr Know-how in bioinformatischer Datenanalyse und Evolutionsbiologie in die Studie ein. Dabei zeigten sich auffallende Zusammenhänge, die sich evolutionsgeschichtlich erklären lassen: Das Mikrobiom hat sich über viele Millionen Jahre in einer Koevolution mit den Wirtstieren mitentwickelt. Eng verwandte Spezies, die einander am Stammbaum der Evolution nahe sind, weisen auch Ähnlichkeiten im Mikrobiom auf. „Auch die Ernährung spielt eine Rolle, aber sie ist nie alleine ausschlaggebend“, erklärt Georg Reischer. „Wenn ein Säugetier dasselbe isst wie ein Vogel, dann hat es deshalb nicht dieselben Bakterien im Darm.“
Der Verunreinigungs-Bio-Detektor
Mit dem Datenmaterial kann man nicht nur die Koevolution von Wirtstieren und den Mikroorganismen in ihrem Verdauungstrakt besser verstehen, sondern auch Verfahren entwickeln, die uns helfen, für sauberes Wasser zu sorgen. An der TU Wien wurde in den letzten Jahren bereits eine Technologie entwickelt, die anhand von DNA-Tests Hinweise auf die Ursache fäkaler Verunreinigungen im Wasser liefert. So kann man zum Beispiel herausfinden, ob die Verunreinigung durch menschliches Abwasser oder Weidetiere entstanden ist. „Nun haben wir einen sehr umfangreichen Datensatz zur Verfügung, mit dem solche Tests auf viel umfassendere und genauere Weise möglich werden“, sagt Andreas Farnleitner.
Originalpublikation:
N. Youngblut et al., “Host diet and evolutionary history explain different aspects of gut microbiome diversity among vertebrate clades”, Nature Communications (2019), DOI: 10.1038/s41467-019-10191-3
15.05.2019, Eberhard Karls Universität Tübingen
Schimpansen graben mit Werkzeugen nach Futter
Forschungsteam filmt im Zoo erstmals, wie die Menschenaffen vorgehen, um an vergrabene Leckereien zu kommen
Um essbare Wurzeln und Knollen auszugraben, nutzen Schimpansen nicht nur ihre Hände, sondern auch spontan Werkzeuge ‒ selbst dann, wenn sie diese Verhaltensweise nie erlernt haben. Dies konnte ein Team der Universitäten Tübingen, Oslo (Norwegen), Linköping (Schweden) und Wisconsin-Madison (USA) mit einer im Zoo durchgeführten Studie zeigen. Dabei wurde auch erstmals gefilmt, wie Schimpansen Werkzeuge zum Graben benutzen. Die Studie wurde im Fachmagazin PLOS ONE veröffentlicht.
Alba Motes-Rodrigo vom Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Tübingen und Kollegen führten die Experimente im Zoo von Kristian-sand (Norwegen) unter Leitung von Dr. Hernandez-Aguilar (Universität Oslo) durch: In einem ersten Durchlauf vergruben sie (in diesem Fall) Früchte und stellten Aststücke als mögliche Werkzeuge zur Verfügung. Die Schimpansen, die vorher noch nie nach Futter gegraben hatten, zeigten ein Repertoire verschiedener Verhaltensweisen, um an die Früchte zu kommen, beispielsweise durch Graben, Schaufeln, Bohren oder das Vergrößern der Ausgrabungsstelle. Sie nutzten dafür die Aststücke, die sie sorgfältig auswählten ‒ bevorzugt wurden längere Werkzeuge. Sie fertigten auch eigene Werkzeuge an, hauptsächlich aus der im Gehege vorkommenden Vegetation. In einem zweiten Experiment wurde wieder Futter für die Schimpansen vergraben, sie erhielten aber keine fertigen Werkzeuge. In diesem Fall nutzten die Schimpansen beim Ausgraben die Hände häufiger und länger als etwaige Werkzeuge.
Zwar nahm man bisher an, dass wilde Schimpansen Werkzeuge einsetzen, um unterirdische Speicherorgane von Pflanzen wie Wurzeln und Knollen auszugraben ‒ dies wurde aber nie direkt beobachtet. Die Studie von Motes-Rodrigo und Kollegen hält dieses Verhalten erstmals per Kamera fest.
Die Wissenschaft geht davon aus, dass der Einsatz von Werkzeugen bei der Suche nach Knollen und Wurzeln in der menschlichen Evolution entscheidend war. „Lebensmittel aus der Erde waren in der Nahrung der Frühmenschen, während des Übergangs von bewaldeten zu trockenen Lebensräumen, vermutlich reichlich vorhanden“, sagt Motes-Rodrigo. Leider wisse man bisher wenig über damalige Werkzeuge oder das Vorgehen der Frühmenschen. „Die Daten unserer Studie tragen zu einem besseren Verständnis des frühen menschlichen Verhaltens bei. Schimpansen dienen uns hier als Verhaltensmodelle.“
Originalpublikation:
Motes-Rodrigo, A., Majlesi, P., Pickering, T.R., Laska, M., Axelsen, H., Minchin, T. C., Tennie, C. and Hernandez-Aguilar, R. A. “Chimpanzee Extractive Foraging with Excavating Tools: Experimental Modeling of the Origins of Human Technology”.
PLOS ONE, http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215644
17.05.2019, Deutscher Imkerbund e. V.
Am Weltbienentag auf Schutz der Bienen hinweisen
Kleine Schritte sind gemacht, aber noch lange nicht zufriedenstellend
Am kommenden Montag erinnert der Weltbienentag an die Bedeutung der Wild- und Honigbienen für die Natur und das ökologische Gleichgewicht. Dieser Aktionstag, der erstmals am 20. Mai 2018 begangen wurde, verstärkt, dass diese wichtigen Insekten als Teil einer intakten Umwelt gefährdet sind: Und Wildbienen mehr als Honigbienen!
„Wir sind derzeit in der Situation, dass sich viele Menschen für die Imkerei interessieren und Imker werden. Diese achten auf den Zustand ihrer Völker und können im gewissen Rahmen reagieren, wenn es den Bienen nicht gut geht, was bei Wildbienen schwierig ist. Das heißt jedoch nicht, dass wir mit der Situation zufrieden sind. Denn Parasiten, wie die Varroamilbe, und Viren, unterstützt durch mangelndes Nahrungsangebot für alle Blüten besuchenden Insekten und der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln beeinträchtigen die Gesundheit der Honigbiene. Im schlimmsten Fall brechen Völker zusammen“, so Olaf Lück, Geschäftsführer des Deutschen Imkerbundes e.V. (D.I.B.).
Vor wenigen Tagen hat das Fachzentrum Bienen und Imkerei in Mayen dazu die Ergebnisse seiner Online-Umfrage zu den Völkerverlusten vorgelegt. Diese hatten die Herbstprognose aus 2018 bestätigt, die auf eine bundesweite Wintersterblichkeit 2018/2019 von ca. 13 bis 17 % hindeuteten. Eingegangen waren Meldungen von 11.950 Imkereien aus ganz Deutschland mit insgesamt ca. 186.000 Bienenvölkern. Die Beteiligungsquote lag somit bei ca. zehn Prozent der deutschen Imkerschaft. Die mittlere Verlustquote je Imkerei lag bei gut 15 Prozent. Summiert man die Völker je Region und berechnet daraus die Verluste, ergibt dies eine Verlustquote von 13,8 Prozent. Etwa die Hälfte der Imkereien war zur Auswinterung von Völkerverlusten betroffen. Die Ergebnisse der einzelnen Regionen wurden unter https://deutscherimkerbund.de/download_db.php?katalog_id=0&id=545 veröffentlicht.
Seit Jahren kämpfen die Imkereien immer wieder mit hohen Winterverlusten, die es auch früher schon gab. Jedoch kehren diese seit rund zwei Jahrzehnten in deutlich geringeren Abständen wieder. Auf die Gesamtpopulation gerechnet sind das 2018/2019 immerhin rund 120.000 Völker – nicht nur ein wirtschaftlicher Schaden für die betreffenden Imkereien. Denn die Völker müssen im Frühjahr durch Vermehrung mühsam wieder aufgebaut werden. Aber auch für die Bestäubung von Kultur- und Wildpflanzen und die Honiggewinnung fehlen die Bienen im Frühjahr.
Probleme wie Nahrungsmangel und Pflanzenschutzeinsatz treffen zugleich auch die Wildbienenarten im erheblichen Maß. In Deutschland stehen bereits 300 auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Zusätzlich leiden Wildbienen besonders unter massivem Habitatverlust. Deshalb wird es am Montag anlässlich des Weltbienentages in vielen Regionen Aktionen geben, um den Schutz von Wild- und Honigbienen zu fördern.
Der D.I.B. setzt dazu vor allem auf den sachlichen und fachlich fundierten Dialog zu verschiedenen konkreten Punkten: Im Bereich Zucht liegt die Hoffnung derzeit auf einem Forschungsprojekt, bei dem es um eine geringere Varroa-Reproduktion durch die Förderung von Gegenwehraktionen der Honigbienen selbst geht. Das Bundeslandwirtschaftsministerium fördert das Projekt im Rahmen der Innovationsförderung, auch der D.I.B. investiert eine erhebliche Summe.
Zum Thema Nahrungsmangel liegen ebenfalls viele konkrete Vorschläge, sowohl für Landwirte als auch Kommunen und die Bevölkerung, vor. „Hier ist ein Umdenken sowohl in der Landwirtschaft, aber auch in der Bevölkerung wichtig und langsam spürbar“, meint Lück. Die Entscheidung verschiedener Kommunen, private Steingärten zu verbieten und öffentliche Flächen bienenfreundlich umzugestalten, die kommunale Grünflächenbewirtschaftung im ökologischen Sinne zu verbessern, findet der Verband beispielgebend.
Viel zu tun gibt es dagegen noch im Bereich Pflanzenschutzmitteleinsatz. Auch hier hat der D.I.B. seit Jahren klare Positionen. Ein kleiner Erfolg zeichnet sich derzeit beim Einsatz insektenfreundlicher Spritztechnik in der Landwirtschaft ab. Hier hat der D.I.B. mit dazu beigetragen, dass die dahingehende Umrüstung der Applikationstechnik bestimmter Pflanzenschutzmittel, die sog. Dropleg-Technik, gefördert wird.
In anderen Bereichen muss dagegen noch viel getan werden, z. B. beim Thema Glyphosat. Im November 2017 hatten die EU-Mitgliedstaaten dafür gestimmt, die Zulassung des umstrittenen Wirkstoffes um weitere fünf Jahre zu verlängern. Diese Entscheidung war für den D.I.B. in keiner Weise nachvollziehbar. Sowohl auf Bundesebene als auch alle 19 D.I.B.-Mitgliedsverbände auf Länderebene haben sich strikt und immer wieder gegen den Einsatz dieses Mittels positioniert, denn der Einsatz des Herbizides ist in mehrerlei Hinsicht für die Imkerei nicht tolerierbar. So wird sowohl in der Landwirtschaft, aber auch im privaten Bereich, Begleitgrün vernichtet, das eine wichtige Lebensgrundlage und Nahrung, nicht nur für Honigbienen, sondern für alle Blüten besuchenden Insekten, ist. Außerdem wird seit vielen Jahren bei Untersuchungen des Bienenbrotes (fermentierter Blütenpollen, der als Eiweiß ein wichtiger Nahrungsbaustein für Bienen ist) ein Cocktail an Pflanzenschutzmitteln nachgewiesen, der die Gesundheit und Vitalität der Bienenvölker, vermutlich auch durch die antibiotische Wirkung von Glyphosat, beeinträchtigt.
„Auch haben wir als Lebensmittelerzeuger die Verpflichtung, unser Naturprodukt Honig vor möglichen Einträgen solcher Mittel zu schützen. Daher sind wir auch deshalb gegen den Einsatz und werden uns weiterhin dafür stark machen“, so Lück. „Uns war immer klar, dass Probleme wie Pflanzenschutzmitteleinsatz und Trachtverbesserungen für Bienen langfristig angegangen werden müssen, denn es gilt, eine Vielzahl an Interessen zu berücksichtigen. Kleine Schritte in die richtige Richtung sind gemacht. Aber für uns ist es nur ein Anfang.
Wir müssen weiter am Ball bleiben und stets gemeinsam mit der Politik und der Landwirtschaft und nicht gegen diese. Unsere konkreten Vorschläge liegen auf dem Tisch zuständiger Ministerien und wir sind zur weiteren aktiven Mitarbeit jederzeit bereit. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam positive Schritte für die Bienen erreichen können, wenn jeder ein Stück dazu beiträgt. Und dies auch im Zuge des Weltbienentages“, wünscht sich Lück.
Im D.I.B. sind 121.000 Imkerinnen und Imker organisiert. Sie betreuen derzeit rund 850.000 Bienenvölker in Deutschland.
17.05.2019, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Ernst Haeckel: Vordenker hochmoderner Disziplinen
Wissenschaftshistoriker der Universität Jena erklären Ernst Haeckels Ökologie-Definition
„Unter Oecologie verstehen wir die gesammte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle ,Existenz-Bedingungen‘ rechnen können. Diese sind theils organischer, theils anorganischer Natur; sowohl diese als jene sind, wie wir vorher gezeigt haben, von der grössten Bedeutung für die Form der Organismen, weil sie dieselbe zwingen, sich ihnen anzupassen.“ So definiert der Evolutionsbiologe Ernst Haeckel in seinem 1866 erschienenen Werk „Generelle Morphologie der Organismen“ den Begriff Ökologie – und zwar als erster überhaupt. Wie aktuell seine ursprüngliche Einordnung ist, das haben Biologiedidaktiker der Friedrich-Schiller-Universität Jena nun genauer herausgearbeitet – auf Einladung des renommierten Fachjournals „Trends in Ecology & Evolution“.
„Ökologie ist derzeit sowohl gesellschaftlich als auch wissenschaftlich ein äußerst wichtiges und aktuelles Thema. Jeder spricht darüber“, sagt Dr. Elizabeth Watts aus der Arbeitsgruppe Biologiedidaktik der Universität Jena. „Deshalb haben wir uns einmal mit der Frage beschäftigt, was ihr Erfinder eigentlich genau damit meinte. Dabei haben wir festgestellt, dass Haeckel eine sehr moderne – um nicht zu sagen vorausschauende – Vorstellung davon hatte.“ Für ihn sei Ökologie nicht das gewesen, was Biologen lange Zeit vor allem während des 20. Jahrhunderts darunter verstanden haben. Vielmehr habe er mit seiner Definition bereits dort gestanden, wo sich sie ökologische Forschung in den vergangenen zehn bis 20 Jahren erst hinbewegt habe.
Ökologie als evolutionäre Wissenschaft
Haeckel pflegte in seinen Betrachtungen zur Ökologie einen ganzheitlichen biologischen Ansatz, wie er heute inzwischen üblich ist. Er nahm Darwins Ansatz auf, dass man das Zusammenspiel von Organismen mit ihrer Umwelt und anderen Organismen beachten müsse, um deren Entwicklung zu verstehen. Deshalb ordnete der deutsche Naturforscher die Ökologie als Teil der Physiologie ein und machte sie so zur evolutionären Wissenschaft. Moderne, noch sehr junge Wissenschaftsfelder, wie etwa die ökologische evolutionäre Entwicklungsbiologie (kurz: Eco-Evo-Devo) folgen dem gleichen Ansatz.
Haeckel kaum übersetzt
Dem Autorenteam ist dabei wichtig, die Rolle Haeckels als Vordenker des Begriffs und der damit verbundenen Disziplin hervorzuheben. Denn vielen ihrer Kollegen ist das gar nicht bewusst. „Haeckels wissenschaftliche Werke liegen bis heute kaum in anderen Sprachen vor, nur seine eher weltanschaulich geprägten Bücher sind beispielsweise ins Englische übersetzt worden“, sagt Mitautor PD Dr. Georgy Levit. Lange Zeit sei das kein Problem gewesen, da Deutsch durchaus den Status einer internationalen Sprache in der Wissenschaft hatte. Doch das änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg – mit erheblichen Folgen für die internationale Haeckel-Rezeption. „Wenn wir heute in internationalen Fachjournalen Artikel zu Haeckel veröffentlichen, dann müssen wir im Vorfeld einzelne Sätze und Passagen aus seinen Werken übersetzen. Manchmal diskutieren wir tagelang, bis wir die richtige englische Formulierung gefunden haben, die das ausdrückt, was der Autor sagen wollte“, ergänzt Watts.
Neben dem Sprachproblem hat auch Haeckels Image dazu geführt, dass seine wissenschaftliche Arbeit wenig Beachtung fand. „Sein wissenschaftlicher Ruf hat durch Betrugsvorwürfe und seine Anschauungen zur Rassentheorie erheblich gelitten“, sagt Uwe Hoßfeld, der sich an der Universität Jena seit Jahrzehnten mit dem berühmten Biologen beschäftigt. „Diese Kritik können und wollen wir nicht wegdiskutieren – sie sind ein Teil unserer Auseinandersetzung mit dem Evolutionsbiologen. Allerdings schmälert das nicht seine Leistungen für die Forschung.“
Entwicklung der modernen Wissenschaft stark geprägt
Die Jenaer Gruppe will deshalb mit ihrer Arbeit zeigen, dass Ernst Haeckel die Entwicklung der modernen Wissenschaft stark geprägt hat. So entsteht derzeit eine ganze Reihe von Aufsätzen, die sowohl seine internationale Wirkung belegen als auch seinen Einfluss auf einzelne Wissenschaften beschreiben. Elizabeth Watts sieht dabei erste Erfolge: In ihrem Heimatland, den USA, sei bereits eine Debatte um Haeckel und seine wissenschaftlichen Leistungen entstanden.
Originalpublikation:
E. Watts, U. Hoßfeld, Georgy S. Levit: Ecology and Evolution – Haeckel’s Darwinian paradigm, Trends in Ecology & Evolution, 2019, DOI: 10.1016/j.tree.2019.04.003
17.05.2019, Ludwig-Maximilians-Universität München
Echoortung von Fledermäusen – Exzellente Navigation mit wenig Information
LMU-Forscher widerlegen bisherige Annahmen über die Echoortung: Fledermäuse haben deutlich weniger räumliche Daten zur Verfügung als bislang gedacht. Dennoch ist ihre Navigation exzellent.
Fledermäuse orientieren sich in der Dunkelheit mithilfe von Echos, wofür sie Ultraschall-Signale ausstoßen. LMU-Forscher widerlegen nun bisherige Annahmen über ihre Echoortung. „Bislang ging man davon aus, dass eine Art Hörbild mit räumlichen Informationen entsteht, wenn Fledermäuse Laute aussenden und sie auch die Lücken zwischen Objekten wahrnehmen können. Diese Vorstellung ist falsch. Unsere Experimente zeigen, dass Fledermäuse kein räumliches Auflösungsvermögen haben. Sie navigieren auf der Basis von extrem wenig räumlichen Informationen. Ihr Navigationssystem funktioniert völlig anders, als wir es kennen“, sagt Lutz Wiegrebe, Professor am Department Neurobiologie der LMU. Die Ergebnisse sind aktuell im Fachmagazin Current Biology veröffentlicht.
Für die Studie haben die Forscher mit Fledermäusen gearbeitet, die darauf dressiert waren, zu signalisieren, wenn sie Reflexionen von Objekten erkennen. Im Versuchsaufbau kamen von rechts und links Störreflexe, während die Tiere zugleich ein Objekt direkt vor ihnen erkennen sollten. „Die Fledermäuse waren von den Störreflexen extrem irritiert. Erst wenn die seitlichen Objekte relativ weit weg waren, haben sie das Objekt vor sich erkannt.“
Als visuelles Experiment wäre die Aufgabe sehr einfach. Das visuelle System liefert über die Sehzellen in der Retina sofort eine sehr gute räumliche Auflösung. „Echoortung funktioniert völlig anders als die visuelle Abbildung“, erklärt Lutz Wiegrebe. „Die Sinneszellen in den Ohren kodieren nicht Raumachsen, sondern Frequenz und Zeit. Rauminformation muss daraus erst neuronal berechnet werden. Unsere Experimente zeigen, dass das räumliche Auflösungsvermögen von Fledermäusen um ein Vielfaches (um drei Größenordnungen) schlechter ist als die Auflösung des visuellen Systems des Menschen. Fledermäuse „sehen“ per Echoortung sozusagen ein extrem verschwommenes Bild. Eine visuell einfache Aufgabe wie: „Sage mir, wie viele Finger einer Hand ich hochhalte“, ist biosonar sehr schwer zu lösen. Trotzdem navigieren Fledermäuse sehr erfolgreich“, sagt Wiegrebe. Die Forscher nehmen an, dass die Fledermäuse diese schlechte Wahrnehmung ausgleichen, indem sie während des Fluges fortlaufend die räumlichen Informationen über Entfernung und Richtung auswerten und sich dabei auf die Position nächstliegender Objekte konzentrieren.
Ihre Ergebnisse könnten Implikationen für technische Anwendungen haben. „Beim autonomen Fahren werden laufend Informationen mit der Kamera erfasst, um das Auto zu steuern. Womöglich werden dabei viel mehr Information erfasst als nötig. Fledermäuse verfügen über ein viel einfacheres Navigationsschema und navigieren dennoch exzellent. Sie verfügen nicht über ein 3-D-Bild wie es bei der visuellen Wahrnehmung entsteht“, sagt Lutz Wiegrebe.
In einer ebenfalls kürzlich veröffentlichten Arbeit im Fachmagazin iScience hatten Leonie Baier aus der Arbeitsgruppe von Lutz Wiegrebe und Dr. Holger Goerlitz vom Max-Planck-Institut für Ornithologie gezeigt, dass Fledermäuse sehr sensitiv für verschiedene Raumfrequenzen sind. Dadurch gelingt es ihnen zum Beispiel ein Insekt über einer Wasseroberfläche zu erkennen. „Aus unserer neuen Arbeit wissen wir nun, dass die Fledermäuse diese Informationen aber nicht räumlich auflösen können“, sagt Wiegrebe. In dem Moment, wo neben dem Insekt etwa auch Pflanzen auf der Wasseroberfläche schwimmen, können die Tiere ihre Beute nicht erkennen.
Originalpublikation:
Cornelia Geberl, Kathrin Kugler, Lutz Wiegrebe: The spatial resolution of bat biosonar quantified with a visual resolution paradigm. In: Current Biology 2019
A. Leonie Baier, Lutz Wiegrebe, Holger R. Görlitz: Echo-Imaging Exploits an Environmental High-Pass Filter to Access Spatial Information with a Non-Spatial Sensor. In: iScience. 2019
Alle Informationen zur Stunde der Gartenvögel (10. – 12. Mai) gibt es hier.



