12.07.2021, Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) e. V.
Bartgeier Wally ebenfalls erfolgreich ausgeflogen
Auch zweiter ausgewilderter Bartgeier hat Felsnische verlassen – Gute Beobachtungsmöglichkeiten in kommenden Wochen – Bartgeier-Führungen buchbar
Vier Tage nachdem mit „Bavaria“ der erste deutsche Bartgeier im Nationalpark Berchtesgaden ausgeflogen ist, hat nun auch der zweite Jungvogel „Wally“ die gesicherte Felsnische verlassen. „Wally saß am unteren Ende der Nische in der Sonne und ist um 6:18 Uhr einfach schnurstrakts herausflogen. Sie ist dann ungefähr 100 Meter in einem flachen Streckenflug an der Felswand entlanggesegelt und in einer Felsrinne außerhalb unserer Sichtweite gelandet“, sagt der LBV-Projektleiter und Bartgeier-Experte Toni Wegscheider. Beobachtet wurde der Flug vom erfahrensten Bartgeier-Experten Europas, dem Österreicher Michael Knollseisen, der das Team der ersten deutschen Auswilderung regelmäßig unterstützt: „Dies ist bereits meine 21. Auswilderung, die ich begleiten durfte und trotzdem ist jeder Ausflug immer wieder ein absolut ergreifender Moment für mich.“ Wegen seiner Größe ist der erste Ausflug der Bartgeier kein erhabener Moment, sondern eher vergleichbar mit einem großen Hopser. „Die beiden jungen Bartgeierweibchen sind nun ein Teil der faszinierenden Natur in den bayerischen Alpen und können in den kommenden Wochen beim Flugtraining im Nationalpark beobachtet werden“, so der Nationalpark-Projektleiter Jochen Grab. Am 10. Juni hatten der bayerische Naturschutzverband LBV und der Nationalpark Berchtesgaden im Klausbachtal die ersten Bartgeier über 100 Jahre nach ihrer Ausrottung in Deutschland ausgewildert.
Bavaria, die ältere der beiden Bartgeierdamen, war bereits am frühen Donnerstagmorgen erfolgreich ausgeflogen, und zeigte sich von Wallys Ausflug unbeeindruckt. Bavaria frisst weiter regelmäßig das in der Nähe der Nische ausgelegte Futter, viel geflogen ist sie seitdem jedoch noch nicht. „Die meiste Zeit verbrachte sie am Wochenende sitzend, wobei sie sich häufig etwas unsicher hin und her drehte, immer wieder die Flügel öffnete und die Hangwinde studierte“, erzählt Toni Wegscheider. Hebt sie mit ihrer beeindruckenden Größe dann aber doch mal ab, ist sie in der Luft bei ihren derzeitigen Steig- und Kurvenflügen sehr elegant. „Als sie am Samstag zu einem ihrer wenigen Flüge ansetzte, war ein richtiges Raunen in der gesamten Halsgrube zu hören“, berichtet Wegscheider. Bavaria hält das Projektteam aus LBV und Nationalpark trotzdem auf Trab. „Im Moment übernachtet Bavaria noch gerne in Steinschlagrinnen. Natürlich kann das gefährlich für sie sein und wir hoffen, dass Wally sicherere Übernachtungsplätze auswählt. Heute Abend werden wir sehen, wohin sich Wally für ihre erste Nacht zurückzieht. Das ganze Bartgeierteam drückt Bavaria und Wally ganz fest die Daumen, dass ihnen nichts zustößt“, hofft Jochen Grab.
Nachdem Bavaria den Sonntag aufgrund des regnerischen Wetters ohne Thermik mit durchnässten Flügeln sitzend in der Felswand verbracht hat, wird sie heute bei schönem Wetter weitere Startversuche unternehmen und umhersegeln. Da ihr Flugradius bald schon einige hundert Meter betragen wird, haben die Projektmitarbeiter*innen bereits Futter in Nischen in weiterer Entfernung ausgelegt, auch um sie damit vielleicht aus dem Steinschlaggebiet zu locken. Mit dem Ausflug der Vögel, wird auch das Projektteam von LBV und Nationalpark mobiler. „Wally wird sich bei ihrem Flugverhalten sicher an Bavaria orientieren und sich Aufwindbereiche und Futterplätze von ihr abschauen. Vielleicht wird man sie bald auch mal gemeinsam fressen oder in derselben Felsnische übernachten sehen“, sagt Toni Wegscheider.
Erste Bartgeier-Führungen buchbar
Am offiziellen Bartgeier-Infostand an der Halsalm, der auf einer Wanderroute liegt, kamen am Samstag bereits viele Besucher*innen vorbei, die sich gezielt nach den Aufenthaltsorten der beiden Geierdamen erkundigten und die Aktivitäten der beiden vorher über die Webcams im Internet verfolgt hatten. Projektmitarbeitende geben gerne Tipps, wo man beim Beobachten Bavaria und Wally am wenigsten stört. Vor allem Naturfotograf*innen sind angehalten, großen Abstand zu den beiden Bartgeiern zu halten. Nationalpark-Ranger sind vermehrt im Einsatz, um die jungen Bartgeier vor aufdringlichen Gästen zu schützen. Am Mittwoch findet die erste LBV-Bartgeier-Führung statt, auf der jede*r die beiden Junggeier fliegend erleben kann. Anmeldung und nähere Infos unter bartgeier@lbv.de. Auch der Nationalpark Berchtesgaden bietet regelmäßig Bartgeier-Führungen an, eine Anmeldung ist erforderlich. Informationen gibt es unter www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de im Bereich Veranstaltungen.
Bei ihren zukünftigen Ausflügen und Streifzügen durch den Nationalpark Berchtesgaden und später durch die Alpen werden die beiden Bartgeierweibchen in den kommenden zwei Jahren auch dank ihrer eindeutigen Flügelmarkierungen für jede*n mit dem Fernglas gut zu erkennen sein. Dabei lassen sie sich ganz einfach unterscheiden: Wally mit dem Doppel-L im Namen hat ihre zwei unterschiedliche Bleichstellen in derselben Schwinge. Bavaria mit dem V im Namen hat unter anderem zwei gebleichte Federn im Stoß, der als Schwanz ja ähnlich wie ein der Buchstabe V geformt ist. Der LBV ruft deshalb alle dazu auf, den bayerischen Naturschützer*innen in Zukunft vor allem außerhalb des Auswilderungsbereichs alle Sichtungen der beiden Geier per E-Mail zu melden unter bartgeier@lbv.de. Wenn möglich sollte dabei der Geiername, die Flugrichtungen – also woher und wohin – und mögliche Aktivitäten beschrieben werden. Am wichtigsten ist dabei allerdings, dass immer ein Foto oder Video mitgeschickt wird, selbst wenn es nur unscharf mit dem Smartphone aufgezeichnet wurde.
In Kürze werden dank der angelegten GPS-Sender auch die Flugrouten der beiden Bartgeier auf einer Karte auf der LBV-Webseite www.lbv.de/bartgeier-auf-reisen mitzuverfolgen sein. Dabei werden die Senderdaten der Öffentlichkeit allerdings mit einer Verzögerung von drei Tagen angezeigt. Dies dient der Sicherheit der Vögel und trotzdem erfährt jede und jeder, wo sie überall hingeflogen sind. So kann das Projektteam zum Beispiel Schlafplätze geheim halten und die Vögel vor zu viel menschlicher Aufmerksamkeit schützen.
13.07.2021, Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels
Nach dem Gipfel ist Schluss: Klimawandel bedroht Gebirgs-Schmetterlinge
Verbreitungsgebiet von Gebirgs-Tagfaltern verlagerte sich innerhalb von 60 Jahren 300 Meter bergaufwärts
Ein europäisches Team aus Bonn, Müncheberg und Salzburg hat die Verbreitung von Gebirgs-Schmetterlingen im österreichischen Bundesland Salzburg untersucht. Die Wissenschaftler zeigen in ihrer heute im Nature-Fachjournal „Scientific Reports“ erschienenen Studie, dass die Gebirgs-Tagfalter in den letzten 60 Jahren im Schnitt um über 300 Meter in die Höhe gewandert sind. In niedrigeren Lagen verschwinden die Schmetterlinge und tauchen bergaufwärts wieder auf – die Forschenden sehen darin eine Reaktion auf die Klimaerwärmung und den Beginn einer grundlegenden Veränderung der Natur.
Heiße und trockene Sommer werden in Mitteleuropa immer häufiger. „Selbst in den vermeintlich kühleren Bergregionen sehen wir die Effekte des globalen Klimawandels“, erklärt Prof. Jan Christian Habel von der Paris-Lodron-Universität Salzburg, Seniorautor der aktuellen Studie, und fährt fort: „Wir haben daher untersucht, wie sich Gebirgs-Tagfalter im Bundesland Salzburg innerhalb der letzten 60 Jahre an diese geänderten Umweltbedingungen angepasst haben.“
Das österreichisch-polnisch-deutsche Team hat hierfür historische Aufzeichnungen von 5836 Tagfalterbeobachtungen aus den Datenbanken des „Hauses der Natur Salzburg“ mit hochauflösenden Klimadaten von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Salzburg korreliert und so die Verbreitungsgebiete der Tiere im Zeitraum 1960 bis 2019 analysiert. „Unsere Daten zeigen, dass sich die Lebensräume der Schmetterlinge des Salzburger Landes seit mehreren Jahrzehnten in höhere Lagen verschieben“, erläutert Erstautor Dr. Dennis Rödder vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (Museum Koenig) in Bonn die Ergebnisse. Im Schnitt konnten die Forscher eine Verschiebung der Verbreitung der Gebirgs-Tagfalter um etwa 300 Meter bergaufwärts innerhalb von nur 60 Jahren nachweisen.
„Schmetterlinge reagieren hochsensibel auf Klimaveränderungen und folgen gewissenmaßen ihrer spezifischen ökologischen Nische, in der sie die Umweltbedingungen vorfinden, die sie zum Überleben brauchen“, ergänzt Prof. Thomas Schmitt vom Senckenberg Deutschen Entomologischen Institut in Müncheberg und fährt fort: „Da es in Mitteleuropa wärmer wird, verlagern zahlreiche Arten ihr Verbreitungsgebiet in höhere Lagen. Das kann vor allem für Gebirgsarten zum Problem werden, denn solche vertikalen Verschiebungen sind endlich. Ihr gesamter Lebensraum wird – bedingt durch die Topographie – kleiner und die Frage bleibt, was passiert, wenn die Arten an den Gipfeln angekommen sind?“
Laut der Studie werden zudem auch Interaktionen zwischen Arten gestört oder können nicht mehr stattfinden. Futterpflanzen von Schmetterlingen reagieren beispielsweise langsamer auf klimatische Veränderungen als ihre Konsumenten. „Vereinfacht könnte man sagen, dass die Pflanzen aufgrund ihrer geringeren Mobilität nicht schnell genug mitwandern können. Ein Beispiel hierfür ist der Natterwurz-Perlmutterfalter (Boloria titania), dessen Verbreitungsgebiet sich immer weniger mit dem seiner bevorzugten Futterpflanze, dem Schlangen-Knöterich (Bistorta officinalis) überlappt.“
Alle Autoren bestätigen in ihrer Studie, dass sich die Natur weltweit durch Klimawandel, Landnutzungswandel und Verlust der Artenvielfalt seit mehreren Jahrzehnten grundlegend ändert. „Der stille Gipfelsturm der Schmetterlinge ist ein Fanal, um uns die Brisanz der Klimakrise zu verdeutlichen, der als lauter Weckruf verstanden werden muss. Wir befinden uns mitten in einer grundlegenden, rasant ablaufenden Veränderung der Umwelt. Zu glauben, dass die Effekte des Klimawandels nur in fernen Ländern existenzbedrohend sind, ist falsch und gefährlich!“ so der Appell der Wissenschaftler.
Quelle: Rödder, D., Schmitt, T., Gros, P. et al. Climate change drives mountain butterflies towards the summits. Sci Rep 11, 14382 (2021).
https://doi.org/10.1038/s41598-021-93826-0
13.07.2021, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) im Forschungsverbund Berlin e.V.
Emotionen und Kultur sind wichtigste Faktoren für Akzeptanz von Managementstrategien für Raubtiere in Tansania
Emotionen gegenüber und die kulturelle Bedeutung großer Raubtiere sind bessere Indikatoren der Akzeptanz von Managementstrategien durch die lokale Bevölkerung als die Höhe der Verluste an Nutztieren. Dies ist das Ergebnis einer neuen interdisziplinären Untersuchung unter Leitung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW). Sie führten Befragungen unter Massai-Hirten im Ngorongoro-Schutzgebiet in Tansania durch und konzentrierten sich dabei auf die drei dort vorkommenden großen Raubtierarten Tüpfelhyäne, Löwe und Leopard und drei denkbare Managementstrategien „keine Maßnahmen“, Umsiedlung und Abschuss.
Soziokulturelle Variablen erwiesen sich als Schlüssel zum Verständnis der Beziehungen zwischen den Massai und Raubtieren. Dies stelle den traditionellen Fokus von Managementstrategien auf die Verluste an Nutztieren in der Mensch-Raubtier-Konfliktforschung in Frage, so die Wissenschaftler. Die Ergebnisse sind in der frei zugänglichen wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Frontiers in Conservation Science“ veröffentlicht.
Für die Umsetzung erfolgreicher Wildtiermanagement-Strategien ist die Unterstützung der lokalen Bevölkerung erforderlich, doch die Beziehung zwischen der Bevölkerung vor Ort und großen Raubtieren ist oft komplex: Einerseits gelten die Tiere als charismatisch und emotional anziehend und haben oft eine hohe kulturelle Bedeutung. Daher wurde vermutet, dass naturschutzorientierte Managementstrategien dann erfolgreich sind, wenn sie mit positiven Emotionen wie Freude oder Stolz verbunden sind. Dies gilt auch für die kulturelle Bedeutung von großen Raubtieren wie Hyänen, Löwen oder Leoparden. Auf der anderen Seite wurden negative Emotionen wie Angst und Ekel sowie negative Erfahrungen wie wiederholte Risse von Nutztieren – der traditionelle Fokus der Mensch-Raubtier-Konfliktforschung – vorgeschlagen, um die Akzeptanz von invasiven Maßnahmen wie Umsiedlung und Abschuss vorherzusagen. Frühere Untersuchungen betrachteten Emotionen, kulturelle Bedeutung und faktische Verluste separat. So war es bislang nicht möglich zu sehen, welcher Faktor die beste Vorhersagekraft hat und welcher daher von Wildtiermanagern priorisiert werden sollte.
„Wir haben in unserer Untersuchung zum ersten Mal mehrere Faktoren gleichzeitig für mehrere Raubtiere bewertet, um festzustellen, welcher Faktor die Akzeptanz von häufig angewandten Managementstrategien am besten vorhersagt“, erklärt Erstautor Arjun Dheer (Leibniz-IZW). Die Befragungen zu Tüpfelhyänen (Crocuta crocuta), Löwen (Panthera leo) und Leoparden (Panthera pardus) unter Massai-Hirten wurden im Ngorongoro-Schutzgebiet (NCA) in Tansania durchgeführt. „Das NCA ist ein Schutzgebiet, das in seinem Managementplan sowohl den Schutz der Wildtiere als auch die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung berücksichtigt“, so Dheer. „Die von uns ausgewählten Arten sind für die Mehrzahl der Verluste an Nutztieren in der Region verantwortlich, doch frühere Forschungen in anderen Gebieten zeigten, dass die Menschen sie sehr differenziert betrachten“, erklärt Dr. Oliver Höner (Leibniz-IZW), Co-Senior-Autor der Arbeit. Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Akzeptanz der Strategien Nichtstun (Schutz der Raubtiere gilt weiterhin), Umsiedlung und Abschuss. Die Befragten bewerteten die Emotionen Freude, Ekel und Angst sowie die kulturelle Bedeutung der einzelnen Raubtierarten. Sie wurden auch um Angaben dazu gebeten, wie viele Rinder, Ziegen, Schafe und Esel sie in den vorangegangenen drei Jahren an die Raubtiere verloren hatten.
Das zentrale Ergebnis der Umfrage ist, dass Emotionen und die kulturelle Bedeutung die Akzeptanz bestimmter Managementstrategien zuverlässiger vorhersagen als die Höhe der Verluste an Nutztieren. „Unter den Emotionen war Freude der stärkste Prädiktor; sie war verbunden mit einer Präferenz für Nichtstun und einer negativen Bewertung von Umsiedlung und Abschuss. Die kulturelle Bedeutung zeigte einen ähnlichen Trend wie die Freude“, erklärt Dheer. Insgesamt lehnte eine große Mehrheit der Befragten Umsiedlung und Abschuss ab. „Dies zeigt, dass diejenigen Wissenschaftler*innen auf dem Holzweg sind, die sie sich bei der Erstellung von Managementplänen für Raubtiere allein auf Risse, Verluste und negative Emotionen konzentrieren“, erklärt Co-Seniorautorin Dr. Tanja Straka (Leibniz-IZW und TU Berlin).
„Unsere Ergebnisse untermauern die Rolle von Emotionen, Wahrnehmungen und Sichtweisen in der Beziehung von Menschen und Wildtieren“, schließt Dheer. Die traditionelle Betonung der Viehverluste als primäre Ursache fehlender Toleranz gegenüber großen Raubtieren stellen die Autor*innen in Frage: Es sei offensichtlich, dass Emotionen und die kulturelle Bedeutung berücksichtigt werden müssen, auch bei Arten, die mit sehr unterschiedlichen Assoziationen belegt sind. Mehrgleisige Ansätze, die Emotionen und kulturelle Faktoren neben den Zahlen und Fakten zu Verlusten berücksichtigen und die lokale Bevölkerung eng einbinden, können demnach helfen, den Weg für eine dauerhafte Koexistenz von Menschen und Raubtieren zu ebnen.
Originalpublikation:
Dheer A, Davidian E, Jacobs MH, Ndorosa J, Straka TM†, Höner OP† (2021): Emotions and cultural importance predict the acceptance of large carnivore management strategies by Maasai pastoralists. Frontiers in Conservation Science. DOI: 10.3389/fcosc.2021.691975.
14.07.2021, Deutsche Wildtier Stiftung
Richtung Süden immer auf Sendung
Deutsche Wildtier Stiftung finanziert die Besenderung des Waldrapp-Nachwuchses aus der Brutkolonie Burghausen in Bayern
Auf der Burg zu Burghausen in Bayern übergibt Prof. Dr. Klaus Hackländer, Vorstand der Deutschen Wildtier Stiftung, am Feitag sechzehn kleine Rucksacksender mit Solarzellen für den Waldrapp-Nachwuchs aus der Brutkolonie Burghausen. Gemeinsam mit dem Tiergarten Schönbrunn ist die Deutsche Wildtier Stiftung ein Partner bei dem Wiederansiedlungsprogramm des Waldrapps Geronticus eremita in Europa.
In den Nischen der Burgmauer in Burghausen sind in diesem Jahr in fünf Nestern bereits sechzehn Küken geschlüpft. „Die Besenderung ist eine essenzielle Grundlage zur Erforschung des Zugverhaltens der Jungvögel Richtung Toskana“, sagt Prof. Hackländer. „Gleichzeitig können effektive Bedrohungen wie die illegale Vogeljagd in Mittelmeerländern aufgedeckt werden.“ Auch schlechte Witterungsbedingungen sowie Stromleitungen sind als Todesursache für die Vögel nicht selten.
Schon vor rund 400 Jahren war der Waldrapp, der mancherorts auch Klausrapp genannt wird, in ganz Europa ausgerottet; jetzt kommt er zurück und soll eine gesicherte Zukunft erhalten. Inzwischen gibt es im Rahmen des Projektes schon wildlebende Waldrappe, die in Brutgebieten in Bayern, Salzburg und Baden-Württemberg brüten. Im Rahmen des europäischen LIFE Gemeinschaftsprojektes sollen Brutkolonien dieser in der Roten Liste der IUCN als bedroht gelisteten Zugvogelart in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz weiter angesiedelt werden. Die Deutsche Wildtier Stiftung hilft bei der Wiederansiedlung in Deutschland mit.
„Damit der Waldrapp sich als wilder Kulturfolger bei uns wieder zu Hause fühlt, muss er sein altes Verhalten, nämlich das Wegziehen im Winter, neu lernen“, so Hackländer. Der Wildtierbiologe weiß: „Findet der junge Waldrapp im ersten Lebensjahr die Zugroute ins Winterquartier nicht, wird er es nie schaffen, auf eigenen Beinen zu stehen.“ Um den Flug jedes einzelnen Vogels genau verfolgen zu können, tragen die Waldrappe während des Fluges ihre kleinen Rucksacksender. „Wenn sie erfolgreich ihr Ziel erreichen, sind wir einer gelungenen Wiederansiedlung noch einen Schritt näher“, sagt der Vorstand der Deutschen Wildtier Stiftung.
14.07.2021, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Langfristige Klimaregulierung hat sich mit der Ausbreitung von Meerestieren und Landpflanzen verändert
Geowissenschaftliche Studie zeichnet Karbonat-Silikat-Zyklus über drei Milliarden Jahre hinweg anhand von Lithium-Isotopenwerten nach
Das Klima auf der Erde war über einen langen Zeitraum hinweg relativ stabil. So herrschten während drei Milliarden Jahren warme Temperaturen mit hohen Kohlendioxidwerten vor – bis vor etwa 400 Millionen Jahren eine Veränderung einsetzte. Eine neue Studie deutet darauf hin, dass dieser Wandel vor 400 Millionen Jahren mit einer fundamentalen Veränderung im Karbonat-Silikat-Zyklus einherging. „Der Wechsel vom präkambrischen Zustand zum heutigen modernen, eher instabilen Klimageschehen kann wahrscheinlich auf die Entstehung und Ausbreitung von neuen Lebensformen zurückgeführt werden“, sagt Prof. Dr. Philip Pogge von Strandmann, Geowissenschaftler an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU). Er hat zusammen mit Forschenden der Yale University, insbesondere Boriana Kalderon-Asael und Prof. Dr. Noah Planavsky, die langfristige Entwicklung des Karbonat-Silikat-Zyklus anhand von Lithium-Isotopen in Meeressedimenten nachverfolgt. Der Zyklus gilt als ein Schlüsselmechanismus für die Steuerung des Erdklimas, weil er das Kohlendioxidniveau und damit die Temperatur reguliert. Die Forschungsarbeit wurde in der renommierten Wissenschaftszeitschrift Nature publiziert.
Karbonat-Silikat-Zyklus ist maßgeblicher Klima-Regulator
Der Karbonat-Silikat-Zyklus hat das Erdklima über lange Zeiten stabil gehalten, obwohl sich die Leuchtkraft der Sonne, die Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre und die Erdkruste teilweise stark verändert haben. Dank dem stabilen Klima wurden die Voraussetzungen für eine dauerhafte Besiedlung der Erde geschaffen und es konnten sich über Milliarden von Jahren zunächst einfache und später komplexe Lebensformen entwickeln. Der Karbonat-Silikat-Zyklus trägt dazu bei, indem er den Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre reguliert: Silikatgestein wird durch Verwitterung und Sedimentation zu Karbonatgestein umgewandelt und Karbonatgestein wird unter anderem durch Vulkanismus wieder zu Silikatgestein transformiert. Bei der Umwandlung von Silikat- zu Karbonatgestein wird Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt, beim umgekehrten Prozess wird Kohlendioxid wieder freigesetzt. „Wir erachten dies als maßgeblichen Mechanismus, der das langfristige Klima der Erde stabilisiert“, sagt Philip Pogge von Strandmann.
Um die langfristigen Karbonat-Silikat-Zyklen nachzuverfolgen und damit ein besseres Verständnis von den genauen Zusammenhängen zu erhalten, die das Erdklima regieren, hat das Forschungsteam das Isotopenverhältnis von Lithium-Isotopen in Meereskarbonaten untersucht. Lithium kommt lediglich in Silikatgestein und seinen Silikat- und Karbonat-Verwitterungsprodukten vor. Das Team analysierte über 600 Proben, die vor Urzeiten in flachen Meeresgewässern als Sedimente abgelagert wurden und von über 100 verschiedenen Gesteinsschichten aus der ganzen Welt stammen, darunter Kanada, Afrika und China. „Auf dieser Basis konnten wir eine neue Datenbank für die vergangenen drei Milliarden Jahre erstellen“, so Pogge von Strandmann.
Diese Daten zeigen, dass das Isotopenverhältnis von Lithium-7 zu Lithium-6 in den Ozeanen im Zeitraum von vor drei Milliarden Jahren bis vor 400 Millionen Jahren niedrig war und dann einen plötzlichen Anstieg erfuhr. Genau zu diesem Zeitpunkt entwickelten sich Landpflanzen und in den Ozeanen breiteten sich Meerestiere wie Schwämme und Strahlentierchen aus, deren Skelett aus Silizium besteht. „Beides hat sich ausgewirkt, aber wir wissen nicht genau, wie die Vorgänge gekoppelt sind“, erklärt Pogge von Strandmann zu den Befunden.
Verlagerung der „Tonfabriken“ auf das Festland beeinflusst Karbonat-Silikat-Zyklus
Die Forschungsarbeit deutet darauf hin, dass sich die Bildung von Ton, ein sekundäres Silikatgestein mit sehr kleiner Partikelgröße, im Laufe der Erdgeschichte stark verschoben hat – und zwar wahrscheinlich durch eine Zunahme der Tonbildung an Land und eine Abnahme in den Ozeanen. Die Tonbildung ist ein zentraler Teil des Karbonat-Silikat-Zyklus und ändert auch das Isotopenverhältnis von Lithium. Sie erfolgt an Land durch eine starke Verwitterung von Silikatgestein, aber auch in den Meeren durch unterschiedliche Prozesse. Die verstärkte kontinentale Tonbildung dürfte, so die Annahme, den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre gesenkt haben. Im Gegensatz dazu setzt die ozeanische Tonbildung CO₂ frei, sodass ihr Rückgang auch den atmosphärischen Kohlendioxidgehalt gesenkt haben wird.
„Dies weist darauf hin, dass sich die Art der Klimaregulierung auf der Erde und der Hauptort, an dem der Prozess stattfindet, im Laufe der Zeit dramatisch verändert hat“, schreiben die Autorinnen und Autoren in dem Beitrag für Nature. „Die Verschiebung vom präkambrischen zum heutigen Zustand kann wahrscheinlich auf wichtige biologische Innovationen zurückgeführt werden – die Ausbreitung von Schwämmen, Strahlentierchen, Kieselalgen und Landpflanzen“, heißt es in der Publikation. Das Ergebnis der veränderten Klimaregulierung macht sich seitdem in einem häufigen Wechsel zwischen Kältephasen mit Vergletscherungen einerseits und wärmeren Zeiten andererseits bemerkbar. Diese Klimainstabilität wiederum trägt dazu bei, dass die Evolution schneller voranschreitet.
Originalpublikation:
Boriana Kalderon-Asael et al.
A lithium-isotope perspective on the evolution of carbon and silicon cycles
Nature, 14. Juli 2021
DOI: 10.1038/s41586-021-03612-1
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03612-1
14.07.2021, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)
Neue Erkenntnisse für den Artenschutz: Schnelle Anpassung erfordert großen Genpool und Schutz auf Landschaftsebene
Wie schnell sich Pflanzen und Tiere von einer Generation zur nächsten an Umweltveränderungen anpassen können, hängt stark von der Größe ihres Genpools auf Landschaftsebene ab, haben Forschende der Universität Birmingham in Großbritannien, der Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) in Belgien und des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) herausgefunden. Anhand von Wasserflöhen zeigten sie, dass eine Population mit einer hohen genetischen Variation sich schnell an Umweltveränderungen anpassen kann. Das verbessert beispielsweise die Überlebenschance gegenüber Fressfeinden, lässt sich aber auch auf andere Bedrohungen übertragen.
Tiere in freier Wildbahn sind ständig Gefahren und Herausforderungen ausgesetzt. Die Evolution ermöglicht es Lebewesen, sich an Umweltveränderungen anzupassen und diese Anpassung über die Gene an ihre Nachkommen weiterzugeben. Die Erforschung dieser evolutionären Anpassungen an Herausforderungen ist wichtig, vor allem angesichts des globalen Wandels. Die Erkenntnisse helfen, den Artenschutz zu optimieren.
Erkenntnis für den Artenschutz: Arten auf Landschafts- oder Regionalebene schützen:
„Unsere Studie unterstreicht, dass die genetische Variation innerhalb einer Population entscheidend für ihre Fähigkeit ist, sich an Umweltveränderungen anzupassen. Wichtig ist, dass wir zeigen konnten, dass die genetische Variation in einer Population nicht nur mit einer großen Anzahl von Individuen zusammenhängt, sondern auch mit der genetischen Variation, die in anderen Populationen in der Region vorhanden ist. Für den Artenschutz bedeutet dies, dass wir Arten auf Landschafts- oder Regionalebene schützen müssen“, sagt Studienleiter Professor Luc De Meester, Direktor des IGB und Forscher an der Freien Universität Berlin und der KU Leuven in Belgien.
Anpassung im Angesicht des Feindes:
Die Forschenden haben die Evolution einer Wasserflohpopulation mithilfe von Eiern* aus verschiedenen Zeiträumen über zwanzig Jahre rekonstruiert. Dafür nutzten sie molekularwissenschaftliche Methoden. Während dieser Zeit waren die Wasserflöhe in unterschiedlichem Maße von Fischen bedroht. Das Forschungsteam konnte zeigen, dass die an- und abschwellende Bedrohung durch die Fressfeinde – der Fraßdruck – eindeutig mit Veränderungen im Erbgut einherging. Die Evolution, die in ihren Genomen stattfand, wurde durch die ständige genetische Variation vermittelt – die Höhe der genetischen Vielfalt, die eine bestimmte natürliche Population beherbergt.
Dr. Anurag Chaturvedi von der School of Biosciences der Universität Birmingham und ehemaliger Doktorand an der KU Leuven erklärt: „Wir waren in der Lage, die genetische Vielfalt einer bestimmten Population von Wasserflöhen über fast zwei Jahrzehnte zu quantifizieren und deutlich zu zeigen, wie schnell die Evolution als Reaktion auf Umweltbelastungen stattfand. Diese Art der Forschung wird von unschätzbarem Wert sein, um die möglichen Auswirkungen zukünftiger Umweltveränderungen auf Tierpopulationen zu verstehen.“
„Wenn die genetische Variation hoch ist, kann die Evolution überraschend schnell sein. Wir müssen besser verstehen, wie die genetische Variation aufrechterhalten wird. Ein gesundes Netzwerk von ausreichend großen Populationen könnte ein Schlüsselfaktor sein“, fasst Luc De Meester zusammen.
*Wasserfloheier als Genarchiv
Wasserflöhe (Daphnien) gehören zu den Krebstieren, sind aber ähnlich klein wie Insekten. Sie sind ein wichtiger Teil des Nahrungsnetzes in unseren Süßgewässern. Der Lebenszyklus von Daphnien umfasst ein ruhendes Stadium. Indem die ruhenden Stadien „aufgeweckt“ werden, können Forschende genetische Veränderungen zu verschiedenen Zeitpunkten in der Vergangenheit quantifizieren und die Evolution beobachten, wie sie in der Natur ablief.
Originalpublikation:
Chaturvedi, A., Zhou, J., Raeymaekers, J.A.M. et al. Extensive standing genetic variation from a small number of founders enables rapid adaptation in Daphnia. Nat Commun 12, 4306 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-24581-z
15.07.2021, Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseen
Wolf-Hund-Mischlinge sicher erkennen
Senckenberg-Wissenschaftler*innen haben mit einem europäischen Team eine neue Methode im Fachjournal „BMC Genomics“ vorgestellt, die es erlaubt, Wolf-Hund-Hybriden anhand von Umweltproben, wie Kot, Haaren oder Speichelresten sicher zu erkennen. Die Methode ist deutlich höher auflösend als herkömmliche Verfahren und soll zukünftig als Standardverfahren dienen, welches eine vergleichbare Erfassung von Hybridisierungsraten in ganz Europa ermöglicht. In derselben Studie zeigen die Forschenden, dass Wölfe in Deutschland derzeit keine erhöhten Anteile von Hundegenen aufweisen.
Im Frühjahr 2000 wurden im Nordosten von Sachsen zum ersten Mal – seit der Ausrottung des Wolfes durch den Menschen um 1850 – in Deutschland wieder wildlebende Wolfswelpen geboren. Nachdem in den folgenden Jahren die weitere Etablierung dieser Tierart nur zögerlich verlief, ist seit gut 10 Jahren eine sehr dynamische Ausbreitung zu beobachten. „Gerade zu Beginn einer solchen Wiederbesiedlung ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wölfe sich mit Haushunden verpaaren, erhöht – schlicht aus Ermangelung einer Auswahl an Geschlechtspartnern oder -partnerinnen der eigenen Art“, erklärt Dr. Carsten Nowak vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt und Leiter des Programmbereiches Genomisches Biomonitoring am LOEWE-Zentrum für Translationale Biodiversitätsgenomik.
Der Wildtiergenetiker von der Senckenberg-Außenstelle Gelnhausen hat nun gemeinsam mit einem europäischen Team aus 10 Ländern eine neue Methode vorgestellt, die es ermöglicht, solche Wolf-Hund-Hybriden mit Hilfe von Umweltproben sicher zu identifizieren. „Wir können solche Mischlinge anhand der DNA aus Kotproben, Haaren oder aus Speichelresten von gerissenen Beutetieren identifizieren. Dabei ist die neue Methode deutlich höher auflösend als herkömmliche Verfahren und erlaubt die sichere Erkennung von Hybridisierungsereignissen auch noch nach mehreren Generationen“, fügt Nowak hinzu. Ermöglicht wird dies durch die gezielte Auswahl von Stellen im Genom, an denen sich Haushunde und Wölfe unabhängig von Rasse und Herkunft voneinander unterscheiden. Mit der neuen Methode mache man sich so unabhängig von Ähnlichkeitsabgleichen individueller genetischer Profile, die auf Referenzproben von Wolf und Hund basieren, heißt es in der kürzlich veröffentlichten Studie.
Die sichere Erkennung von Wolf-Hund-Hybriden ist durch die enge Verwandtschaft von Haushunden und den großen Beutegreifern erschwert – zu sehr können Hybriden in ihren äußerlichen und molekulargenetischen Merkmalen den genetisch reinen Wölfen ähneln. Die bei Wolf-Hund-Verpaarungen gezeugten Mischlinge zu erkennen, ist für das Wolfsmanagement aber wichtig: Hybride sind weiter zeugungsfähig und können Hundegene in die komplette Wolfpopulation streuen, wenn sie sich wieder mit Wölfen paaren. Theoretisch ist es möglich, dass sich hierdurch im Laufe der Zeit immer mehr Hundegene im Genpool des Wolfs ansammeln. „Zudem ist die gesellschaftliche Akzeptanz für wildlebende Wolf-Hund-Hybride gering. Daher werden Hybriden in der Regel aus der freien Wildbahn entnommen. Unsere publiziertes Verfahren erleichtert ihre sichere Identifizierung erheblich“, so Nowak.
In Deutschland wurden bislang nur sehr wenige Hybridisierungen zwischen Wölfen und Haushunden registriert. Zu diesen kam es in Fällen, wo weibliche Wölfe keinen unverwandten „wölfischen“ Paarungspartner fanden, wie 2003 in Sachsen oder 2017 und 2019 in Thüringen. In derartigen Fällen wird meist eine Entnahme der Hybride aus der Natur angeordnet, so dass diese sich nicht weiter mit Wölfen paaren können. Nowak hierzu: „Wir haben in unserer Studie bei den aus Deutschland stammenden Wolfsproben keine erhöhten Anteile von Hundegenen gefunden. Ähnliche Befunde gibt auch in anderen Regionen Europas, in denen Hybriden konsequent entnommen werden und es zudem kaum streunende Haushunde gibt, wie in Skandinavien oder dem Alpenraum“.
Im deutschen Wolfsmonitoring wird die neue Methode bereits routinemäßig eingesetzt – die Forschenden plädieren in ihrer Studie für den standardisierten Einsatz des Verfahrens in ganz Europa. „So könnten wir Gegenden identifizieren, in denen beispielsweise verwilderte Hunde stärker kontrolliert werden müssen, um eine ökologische Trennung zu den Wölfen zu gewährleisten. Ein flächendeckender Einsatz der Methode zur Erfassung der Hybridisierungsraten über Europa würde uns zudem helfen, regionale Unterschiede bei der Vermischung von Wolf und Hund besser zu verstehen“, resümiert die Erstautorin der Studie, Jenni Harmoinen von der Universität Oulu in Finnland.
Originalpublikation:
Harmoinen, J., von Thaden, A., Aspi, J. et al. Reliable wolf-dog hybrid detection in Europe using a reduced SNP panel developed for non-invasively collected samples. BMC Genomics 22, 473 (2021). https://doi.org/10.1186/s12864-021-07761-5
16.07.2021, Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels
Italienische Höhlensalamander in Deutschland?
Nicht-einheimische Arten zählen zu den Hauptproblemen für den Verlust der Artenvielfalt. Unter den Amphibien sind es vor allem einige nicht-einheimische Froschlurche (z.B. Aga-Kröte oder Afrikanischer Krallenfrosch), die großen negativen Einfluss auf fremde Ökosysteme nehmen können. Für Schwanzlurche, also Molche und Salamander, sind nur wenige Fälle bekannt, in denen diese in andere Ökosysteme verschleppt oder ausgesetzt wurden. Seit 2013 ist bekannt, dass es eine kleine Population von Höhlensalamandern im Weserbergland/Solling, Niedersachsen gibt. Jetzt ist die Art sowohl durch genetischen Nachweis als auch aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds als Speleomantes italicus bestimmt.
Konkurrenz mit einheimischen Amphibien oder andere negative Auswirkungen der Art auf die heimische Fauna konnten bisher nicht nachgewiesen werden. Da Höhlensalamander nicht in Deutschland einheimisch sind, ist ein zukünftiges Monitoring der Population notwendig.
Die Höhlensalamander der Gattung Speleomantes sind endemisch in Frankreich und Italien zu finden. Drei der Arten kommen entlang der Apenninen auf dem europäischen Festland vor, während die anderen fünf Arten auf Sardinien verbreitet sind. Trotz des Trivialnamens Höhlensalamander sind die Schwanzlurche nicht auf diese beschränkt und bewohnen auch andere Habitate wie Minen oder Felsspalten, in denen ganzjährig ein dauerfeuchtes und kühles Klima herrscht. Dieses Mikroklima ist von Nöten, da Höhlensalamander zu den Lungenlosen Salamandern (Plethodontidae) gehören und sie den benötigten Sauerstoff durch die Haut aufnehmen.
Seit 2013 ist bekannt, dass es eine kleine Population von Höhlensalamandern im Weserbergland/Solling, Niedersachsen gibt. Da die acht Arten der Höhlensalamander rein äußerlich jedoch äußerst ähnlich und daher schwer zu bestimmen sind, war die genaue Artzugehörigkeit der dortigen Tiere unbekannt und auch weitere Untersuchungen fehlten. So war auch unklar, ob es sich um eine sich reproduzierende, etablierte Population handelt oder ob es nur einige wenige Tiere sind, die dort seit mehreren Jahren überlebt hatten. Aus diesem Grund besuchten die Biologen Philipp Ginal vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (Herpetologie) und Carl-Henning Loske (Ingenieurbüro Loske) die Untersuchungsfläche in Niedersachsen mehrfach, um möglichst viele Höhlensalamander auch fotografisch zu dokumentieren.
Im Herbst letzten Jahres konnten die Forscher insgesamt 70 verschiedene Individuen von Höhlensalamandern entdecken und fotografieren. Drei der Tiere konnten auch an einem zweiten Fangtermin gefunden werden. Loske erklärt: „Da Höhlensalamander ein sehr komplexes und individuell einzigartiges Farbmuster aufweisen, ist die Identifikation von einzelnen Individuen möglich“. Zusammen mit den Kollegen Dennis Rödder vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (Herpetologie) und Thomas Hörren von der Universität Duisburg-Essen schätzten die Forscher die Populationsgröße, also die Zahl der einzelnen Tiere, mittels sogenannter Fang-Wiederfang-Modelle. „Laut unserer Ergebnisse umfasst die deutsche Population zwischen 170 und 485 Tieren und ist damit deutlich größer als bisher angenommen. Der Minimalwert von 170 ist allerdings als eher unrealistisch zu betrachten und so gehen wir von deutlich mehr Individuen aus“ erläutert Ginal.
Weiterhin wurde eine erst kürzlich veröffentlichte, umfangreiche Foto-Datenbank verwendet, um eine erste morphologische Bestimmung der Art vorzunehmen. Die verwendete Fotodatenbank umfasst mehr als 1000 Bilder aller Höhlensalamander-Arten aus verschiedenen lokalen Populationen. „Zudem zeigte der umfassende fotografische Abgleich mit der Datenbank, dass von den acht bekannten Arten lediglich Populationen der Art Speleomantes italicus mit den deutschen Tieren identisch sind. Diese Art kommt im nördlichen und zentralen Apennin vor“ schildert Rödder.
Mittlerweile konnten Kollegen an der Universität Braunschweig die Artzugehörigkeit durch genetische Untersuchungen bestätigen. Beide Forscherteams konnten während ihrer Feldarbeit auch mehrere Jungtiere sowie ein trächtiges Weibchen der Art nachweisen und somit den definitiven Beweis für die Reproduktion belegen. Da Höhlensalamander nicht in Deutschland einheimisch sind, ist ein zukünftiges Monitoring der Population notwendig. Bisher ist die dortige Population jedoch auf eine Felswand von etwa 40 m Länge beschränkt. Konkurrenz mit einheimischen Amphibien oder andere negative Auswirkungen der Art auf die heimische Fauna konnten bisher nicht nachgewiesen werden. Manchmal wurden die Höhlensalamander sogar zusammen mit den heimischen Feuersalamandern oder Bergmolchen in derselben Felsspalte gefunden.
Originalpublikation:
Ginal, P., Loske, C. H., Hörren, T., & Rödder, D. (2021). Cave salamanders (Speleomantes spp.) in Germany: tentative species identification, estimation of population size and first insights into an introduced salamander. Herpetology Notes, 14, 815-822.
19.07.2021, MDR Mitteldeutscher Rundfunk
MDR-Koproduktionen bei Natur- und Umweltfilmfestival ausgezeichnet
MDR-Koproduktionen bei Natur- und Umweltfilmfestival ausgezeichnet
„Der kleine Held vom Hamsterfeld“ und „Rentiere auf dünnem Eis“ wurden beim 20. NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg ausgezeichnet: Der Publikumspreis ging an den in Thüringen gedrehten Film über die bedrohten Feldhamster. Die international viel beachtete Dokumentation „Rentiere auf dünnem Eis“ über dramatische Folgen der Klimaveränderung wurde auf dem Festival mit dem Deutschen Umwelt- und Nachhaltigkeitsfilmpreis geehrt. Beide Filme können in der ARD-Mediathek abgerufen werden.
Das Online-Publikum hat beim renommierten Natur- und Umweltfilmfestival „NaturVision“ in Ludwigsburg die MDR/ARTE/BR/HR-Produktion „Der kleine Held vom Hamsterfeld“ zum Publikumsliebling gekürt. Neben dem Publikumspreis war der Film auch für den Filmmusikpreis nominiert. Im Film von Uwe Müller geht es um das bedrohte Leben der Feldhamster in Deutschland. Denn die Populationen stehen in Folge industrieller Landwirtschaft massiv unter Druck. Monokulturen, Pestizideinsatz und frühere Ernten sowie die Versiegelung von täglich 60 Hektar bedrohen ihre letzten Lebensräume. Exemplarisch erzählt die Doku die Geschichte eines Feldhamsterweibchens in einer der letzten deutschen Hamster-Regionen in Thüringen.
Mit dem Deutschen Umwelt- und Nachhaltigkeitsfilmpreis wurde auf dem diesjährigen Festival die MDR/ARTE-Produktion „Rentiere auf dünnem Eis“ ausgezeichnet. In der Begründung der Jury hieß es u.a.: „Die Bilder dieses Films öffnen den Blick weit über das Schicksal der Nenzen und ihrer Rentiere hinaus. An einem abgegrenzten Bereich zeigt der Film exemplarisch die ganze Tragödie des Klimawandels und mahnt uns, wie ungeheuer wichtig es ist, diesen zu stoppen. Nicht nur die Rentiere bewegen sich auf dünnem Eis.“
In der bereits mehrfach ausgezeichneten Dokumentation der Filmemacher Henry M. Mix und Boas Schwarz werden die dramatischen Folgen der Klimaveränderungen anhand anschaulicher Einzelschicksale und verstörender Bilder auf Rentierhirten und die Natur Sibiriens gezeigt.
19.07.2021, Deutsche Wildtier Stiftung
Achtung, Rehe unterwegs!
Deutsche Wildtier Stiftung: Sommernächte sind bei Rehen Hochzeitsnächte
Rehe leben scheu und zurückgezogen. Vor allem in den Dämmerungsstunden werden sie aktiv und gehen auf Nahrungssuche. In der Paarungszeit, die jetzt beginnt, ist alles anders. In der Rehbrunft fallen beim kleinsten hirschartigen Wildtier in Deutschland alle Hemmungen: Dank der Hormone gibt es kein Halten mehr. Sonst still und leise als Einzelgänger unterwegs, wird von Mitte Juli bis in den August hinein gemeinsam Krach gemacht: Der Bock verfolgt das Weibchen manchmal stundenlang. Er keucht – denn Rennen ist anstrengend – und sie fiept in hoher Stimmlage zurück. „Das schwülwarme Wetter und heftige Sommergewitter tragen noch dazu bei, die tierischen Hormone in Wallungen zu bringen“, sagt Dr. Andreas Kinser, stellvertretender Leiter Natur- und Artenschutz der Deutschen Wildtier Stiftung. „Es kann sein, dass Reh-Paare am helllichten Tag aus dem Unterholz hervorstürmen und dabei vom Menschen keinerlei Notiz nehmen.“
Denn wie es bei Verliebten üblich ist: Wer auf Wolke sieben schwebt, nimmt seine Umwelt kaum noch war. Rehe sind jetzt blind vor Verlangen – und das ist hochgefährlich: „Gerade in der sommerlichen Rehbrunft kommt es häufig zu Autounfällen“, sagt Kinser. Viele Autofahrer unterschätzen die Gefahr, die von den 15 bis 30 Kilogramm schweren Rehen ausgeht. „Bei einem Zusammenprall mit einem Auto, das rund 100 Stundenkilometer fährt, liegt das Auftreffgewicht bei über einer halben Tonne“, sagt der Wildtierexperte. „Das ist lebensgefährlich für Mensch und Tier.“
Alle Rehe werden im Sommer gezeugt. Ziemlich genau 67 Tage nach der Geburt ihrer Kitze ist das weibliche Reh wieder empfängnisbereit: doch das für kaum mehr als 48 Stunden. Ist die Hochzeit vollzogen, macht sich der Bock auf die Suche nach der nächsten paarungsbereiten Reh-Dame in seinem Revier, denn die Tage der Rehbrunft müssen ausgenutzt werden. Im Körper der Weibchen spielt sich dagegen jetzt ein kleines Wunder ab: Die Eizelle, die im Juli oder August befruchtet wurde und sich danach in der Gebärmutter eingenistet hat, teilt sich bis etwa zum Jahreswechsel nicht. Erst nach dieser sogenannten Keimruhe beginnt die normale embryonale Entwicklung. „Durch diesen schlauen Trick der Natur werden die Rehkitze dann mitten im Wonnemonat Mai geboren“, sagt Kinser.
19.07.2021, Universität Osnabrück
Erstmals tödlicher Angriff von Schimpansen auf Gorillas beobachtet: Studie unter Mitwirkung der Uni Osnabrück
Ein Forschungsteam der Universität Osnabrück und des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie aus Leipzig hat erstmals tödliche Angriffe von Schimpansen auf Gorillas in freier Wildbahn beobachtet. Die neuen Erkenntnisse sind unter dem Titel „Lethal coalitionary attacks of chimpanzees (Pan troglodytes troglodytes) on gorillas (Gorilla gorilla gorilla) in the wild“ in der Fachzeitschrift Scientific Reports erschienen: www.nature.com/articles/s41598-021-93829-x
Schimpansen sind in Ost- und Zentralafrika verbreitet und leben in einigen Gebieten, wie dem Loango-Nationalpark in Gabun, mit Gorillas gemeinsam im gleichen Habitat. In dem Park ist auch seit 2005 das Loango-Schimpansenprojekt verortet, das von Dr. Tobias Deschner (Primatologe am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie) und Prof. Dr. Simone Pika (Kognitionsbiologin an der Universität Osnabrück) geleitet wird. Die Forschenden untersuchen in Loango das Verhalten von rund 45 Schimpansen mit einem besonderen Schwerpunkt auf ihre sozialen Beziehungen, Interaktionen mit Nachbargruppen, Jagdverhalten, Werkzeuggebrauch und Kommunikation.
„Interaktionen zwischen Schimpansen und Gorillas galten bislang als entspannt“, so die Verhaltensbiologin Simone Pika: „Wir haben beide Arten regelmäßig friedlich in Futterbäumen beobachtet und unsere Kollegen aus dem Kongo wurden sogar Zeugen von gemeinsamen Spielen zwischen Schimpansen und Gorillas.“
Tödliche Begegnungen zwischen beiden Menschenaffenarten wurden jedoch noch nie dokumentiert. „Unsere Beobachtungen liefern den ersten Beweis dafür, dass die Anwesenheit von Schimpansen einen tödlichen Einfluss auf Gorillas haben kann. Wir wollen nun untersuchen, was die Gründe für die überraschend aggressiven Interaktionen sind“, so Tobias Deschner.
Was genau war passiert? Die Doktorandin von Simone Pika und Tobias Deschner und Erstautorin der Studie, Lara M. Southern, erinnert sich an die erste Beobachtung im Jahre 2019: „Zunächst hörten wir nur Schreie der Schimpansen und dachten, wir würden eine typische Begegnung zwischen benachbarten Schimpansen-Gemeinschaften beobachten. Doch dann hörten wir Brusttrommeln, ein Imponierverhalten, das charakteristisch für Gorillas ist, und stellten fest, dass die Schimpansen auf eine Gruppe von fünf Gorillas gestoßen waren.“
In beiden im Artikel beschriebenen Begegnungen bildeten die Schimpansen eine Koalition und griffen die Gorillagruppen an, woraufhin die beiden Silberrücken und die Weibchen der Gruppen sich und ihre Kinder verteidigten. Die Silberrücken und mehrere erwachsene Weibchen konnten fliehen, während zwei Gorillakinder ihren Müttern entrissen und getötet wurden.
Die Autoren aus Osnabrück und Leipzig führen mehrere Erklärungen für die beobachteten Aggressionen an. Tötungen zwischen verschiedenen Arten können entweder als Jagdverhalten oder als Konkurrenz um Nahrung interpretiert werden. „Es könnte sein, dass das Zusammenleben von Schimpansen, Gorillas und Waldelefanten im Loango Nationalpark in Gabun zu stark erhöhter Konkurrenz um Nahrung geführt hat, die sich in Extremfällen in tödlichen Konflikten zwischen den beiden Menschenaffenarten entlädt“, erklärt Tobias Deschner. Eine solche Situation könnte auch durch den Klimawandel bedingten Rückgang der Produktivität des Regenwaldes bedingt sein, wie er vor kurzem in anderen Nationalparks in Gabun beobachtet wurde.
„Wir stehen erst am Anfang, die Auswirkungen der Nahrungskonkurrenz auf die Interaktionen zwischen den beiden Menschenaffenarten zu verstehen“, sagt Simone Pika. „Unsere Studie zeigt, dass es noch sehr viel über unsere nächsten lebenden Verwandten zu erforschen und zu entdecken gibt, und dass der Loango Nationalpark mit seinem einzigartigen Mosaikhabitat ein einzigartiger Ort dafür ist.“
www.nature.com/articles/s41598-021-93829-x
19.07.2021, Universität Bern
«In vitro»-Zoo hilft, SARS-CoV-2 zu verstehen
Forschende des Instituts für Infektionskrankheiten (IFIK) der Universität Bern und des Instituts für Virologie und Immunologie (IVI) konnten dank innovativer Zellkulturmodelle bestimmen, welche Tiere für eine SARS-CoV-2-Infektion empfänglich sind. Das Team fand heraus, dass die Atemwegszellen von Affen und Katzen besonders leicht von SARS-CoV-2 infiziert werden. Dies legt nahe, bei diesen Tieren und nahen Verwandten eine SARS-CoV-2-Überwachung einzuführen.
Seit Beginn der Pandemie wurde mehrmals berichtet, dass SARS-CoV-2-Übertragungen vom Menschen auf Tiere stattgefunden haben, wie etwa von Tierpflegerinnen und Tierpflegern auf Tiger und Löwen im Bronx Zoo in New York. Bis heute ist jedoch nicht bekannt, welche Tierarten für eine SARS-CoV-2-Infektion besonders empfänglich sind. Dies liesse sich herausfinden, indem eine Vielzahl von Tierarten experimentell mit SARS-CoV-2 infiziert würde, um zu sehen, ob sie dafür anfällig sind. Um solche Versuche zu reduzieren und zu verfeinern, wählten die Forschenden der Universität Bern und des Instituts für Virologie und Immunologie (IVI) einen tierfreundlicheren Ansatz, um diese Frage zu beantworten.
Bau eines «In vitro»-Zoos
Die Forschenden nutzten ihr Wissen über die Anfertigung von innovativen In-vitro-Zellkulturmodellen von menschlichen Atemwegen, um eine umfangreiche Sammlung ähnlicher Modelle von verschiedenen Haus- und Wildtieren zu erstellen. Dazu isolierte das Team Atemwegs-Epithelzellen (AEC) aus den Lungen und Bronchien von verstorbenen Tieren und erstellte eine Zell-Biobank von verschiedenen Tierarten. Dank dieser spezifischen AEC-Kulturmodellen konnten die Forschenden feststellen, ob die entsprechenden Tiere mit SARS-CoV-2 infiziert werden können. Da die Zellen von verstorbenen Tieren isoliert wurden und sich diese isolierten Zellen in einer Petrischale kultivieren und vermehren lassen, waren keine Tierversuche nötig. Bislang enthält die Biobank Zellkulturen von zwölf verschiedenen Tierarten: Rhesusaffe, Katze, Frettchen, Hund, Kaninchen, Schwein, Rind, Ziege, Lama, Kamel und zwei Fledermausarten aus Mittel- und Südamerika.
«Unsere Sammlung ist einzigartig, und bisher sind wir die ersten, die eine so grosse Biobank neuartiger In-vitro-Zellkulturmodelle von verschiedenen domestizierten und wildlebenden Tierarten verwendet haben, um ihre Anfälligkeit für eine SARS-CoV-2-Infektion zu untersuchen», sagt Ronald Dijkman vom Institut für Infektionskrankheiten (IFIK) der Universität Bern.
Katzen und Rhesusaffen als potenzielle «Spillback-Reservoirs» für SARS-CoV-2
Die In-vitro-Ergebnisse stimmten grösstenteils mit zuvor veröffentlichten Studien überein, bei denen Tierversuche verwendet wurden, um die Anfälligkeit verschiedener Tiere für eine SARS-CoV-2-Infektion zu beurteilen. Mittels Sequenzierung des gesamten Genoms des Virus stellten die Forschenden zudem fest, dass sich SARS-CoV-2 in den In-vitro-Modellen von Rhesusaffen und Katzen effizient vermehrte, ohne dass sich das Virus anpassen musste. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass bestimmte Affen- und Katzenarten besonders anfällig für eine SARS-CoV-2-Infektion sein könnten. «Unsere Ergebnisse – zusammen mit zuvor dokumentierten Übertragungen zwischen Mensch und Tier – zeigen, dass eine genaue Überwachung dieser Tiere und anderer naher Verwandter notwendig ist, egal ob bei Wild- Nutz- oder Haustieren», sagt Dijkman.
Die Erkenntnisse können von den zuständigen Behörden wie dem Schweizer Bundesamt für Gesundheit BAG und dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV für die SARS-CoV-2-Überwachung an der Schnittstelle zwischen Mensch und Tier genutzt werden. Insbesondere können sie dazu dienen, Überwachungsprogramme zur Früherkennung einzurichten und anzupassen, um Tiere zu überwachen, die potenzielle «Spillback-Reservoirs» für SARS-CoV-2 sein können. Dijkman erklärt: «Dadurch können wir verhindern, dass sich in Tieren neue SARS-CoV-2-Varianten entwickeln, die wieder auf den Menschen überspringen, und gegen die aktuelle Impfstoffe möglicherweise keinen Schutz bieten.»
Umsetzung des 3R-Prinzips (Replace, Reduce, Refine) in der Coronavirus-Forschung
Die Ergebnisse zeigen auch, dass fortschrittliche In-vitro-Modelle von Zellen aus den Atemwegen verschiedener Säugetiere als alternative Methode eingesetzt werden können, um das Wirtsspektrum von SARS-CoV-2 zu untersuchen – anders als In-vivo-Versuche, die mehrere Einschränkungen aufweisen. «Unsere Studie zeigt, dass es viel Potenzial gibt, um Tierversuche in naher Zukunft zu ersetzen, zu reduzieren und zu verfeinern, und ich hoffe, dass unsere Ergebnisse bei grundlegenden Forschungsfragen Forschende, pharmazeutische Unternehmen und Arzneimittelbehörden davon überzeugen werden, innovative und biologisch relevante In-vitro-Modelle zu verwenden, bevor sie Tierversuche durchführen», sagt Dijkman.
Die Studie wurde von der Europäischen Kommission (Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network «HONOURS»), dem Schweizerischen Nationalfonds SNF (Special call on Coronaviruses), dem deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) unterstützt.
Originalpublikation:
Gultom, M., Licheri, M., Laloli, L., Wider, M., Strässle, M., V’kovski, P., et al., & Dijkman, R. Susceptibility of Well-Differentiated Airway Epithelial Cell Cultures from Domestic and Wild Animals to Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Emerging Infectious Diseases, Juli 2021, https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/7/20-4660_article
20.07.2021, Eberhard Karls Universität Tübingen
Gebrauch von Steinwerkzeugen: Schimpansen leben vor der Steinzeit
Forschungsteam der Universität Tübingen testet, ob Menschenaffen die Fähigkeit besitzen, scharfkantige Werkzeuge herzustellen
Anders als frühe Menschenarten scheinen Schimpansen nicht in der Lage zu sein, spontan scharfe Steinwerkzeuge herzustellen und zu nutzen, auch wenn ihnen dafür alle Materialien zur Verfügung stehen und ein Anreiz besteht. Das ergab eine Studie an insgesamt elf Schimpansen in einem Zoo im norwegischen Kristansand und dem Chimfunshi Wildlife Orphanage, einer Schutzstation in Sam-bia. Durchgeführt wurde sie von Dr. Elisa Bandini und Dr. Alba Motes-Rodrigo von der Universität Tübingen im Rahmen des von Dr. Claudio Tennie geleiteten Projekts STONECULT, das vom Euro-päischen Forschungsrat finanziert wird. Die Studie, die Tennie gemeinsam mit Dr. Shannon McPherron vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig leitete, wurde in der ERC-Fachzeitschrift Open Research Europe veröffentlicht.
„Scharfkantige Steinwerkzeuge, die von frühen Menschen hergestellt wurden, sind mindestens aus den vergangenen 2,6 Millionen Jahren bekannt – zu Beginn der Steinzeit“, berichtet Elisa Bandini. Das Forschungsteam wollte wissen, ob Schimpansen als einer der engsten lebenden Verwandten heutiger Menschen, die Fähigkeit zur spontanen Herstellung solcher Werkzeuge besitzen. „Das war bisher ausschließlich an sogenannten ‚kultivierten‘ Menschenaffen getestet worden, also Affen die trainiert oder vom Menschen aufgezogen wurden, und denen die Herstellungstechniken von Men-schen gezeigt wurden“, sagt Alba Motes-Rodrigo.
Eine Entwicklung der menschlichen Evolution
In den neuen Versuchen erhielten untrainierte Schimpansen zwei verschiedene verschlossene Behälter, die – sichtbar durch eine Plexiglasscheibe – Futter enthielten. An dieses konnten sie nur ge-langen, wenn sie scharfe Steinwerkzeuge herstellten. Sie erhielten einen sogenannten Steinkern und Hammersteine, um selbst scharfkantige Steine von diesem Kern abzuschlagen. Anders als in allen bisherigen Studien erhielten die Menschenaffen in der Studie keine Gelegenheit, sich die Herstellung solcher Werkzeuge abzuschauen. „Obwohl die Schimpansen vermutlich verstanden hatten, dass die Behälter Futter enthielten und auch klar motiviert waren, an diese Belohnung zu kommen, machte keines der Tiere im Test auch nur den Versuch, scharfe Steinwerkzeuge anzufertigen“, stellt Claudio Tennie fest. Das Team schließt daraus, dass Schimpansen diese spontane Fähigkeit nicht besitzen. „Wahrscheinlich können sie dies nur nach intensivem Kontakt mit Menschen und/oder durch Nach-ahmen erlernen“, sagt Tennie, und fügt hinzu „sie befinden sich also, was diese Fähigkeiten betrifft, noch vor der Steinzeit.“
Die Abstammungslinien von Menschen und Menschenaffen trennten sich vor rund sieben Millionen Jahren. Die Fähigkeit, scharfe Steinwerkzeuge herzustellen, habe sich wohl erst lange nach dieser Trennung in der menschlichen Linie entwickelt, sagt das Forschungsteam. Dafür seien bestimmte Fähigkeiten nötig, die sich erst in der Evolution unserer menschlichen Vorfahren herausbildeten.
Originalpublikation:
Elisa Bandini, Alba Motes-Rodrigo, William Archer, Tanya Minchin, Helene Axelsen, Raquel Adriana Hernandez-Aguilar, Shannon P. McPherron, Claudio Tennie: Naïve, unenculturated chimpanzees fail to make and use flaked stone tools. Open Research Europe 2021,
https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/1-20/v2
22.07.2021, Veterinärmedizinische Universität Wien
Hunde als „Gedankenleser“
Dass Hunde vielfach als der „beste Freund des Menschen“ bezeichnet werden, ist bekannt. Eine soeben erschienene Studie des Clever Dog Labs an der Vetmeduni Vienna zeigt nun anhand eines Verhaltenstests erstmals, dass dies längst nicht alles ist. Demnach sind Hunde in gewisser Weise in der Lage, die Gedanken von Menschen zu „erraten“. Mit diesem „False Belief“-Verständnis wären die Hunde im Tierreich nicht nur der beste, sondern auch der verständnisvollste Freund des Menschen.
Bereits seit mehreren Jahren untersuchen WissenschafterInnen der Vetmeduni Vienna am Clever Dog Lab des Messerli Forschungsinstituts die Fähigkeit von Hunden zum Perspektivenwechsel – eine Fähigkeit, die eine Vorstufe des Verstehens von Überzeugungen ist und bis dato außer beim Menschen nur bei Menschenaffen nachgewiesen wurde. In einer früheren Studie konnten Hunde den Unterschied zwischen einer menschlichen Helferin, die den Ort des versteckten Futters sehen konnte, und einer, welche nur raten konnte, erkennen. Allerdings ist diese Erkenntnis nicht ausreichend, um zu beweisen, dass Hunde über die geistigen Zustände von Menschen Vermutungen anstellen.
Hunde können „Gedanken lesen“
In ihrer nun soeben veröffentlichten Studie untersuchten die ForscherInnen deshalb in einem weiteren Schritt, ob Hunde bei Menschen auch den Unterschied zwischen einer wahren und einer falschen Überzeugung (von Menschen) erkennen können. Dieses sogenannte „False Belief“-Verständnis ist so etwas wie der „Goldstandard“, um den Beginn des „Gedankenlesens“ („Mindreading“ oder „Theory of Mind“) bei Kindern im Alter von etwa vier bis fünf Jahren zu demonstrieren.
Laut Ludwig Huber, Leiter des Messerli Forschungsinstituts und der Abteilung Vergleichende Kognitionsforschung an der Vetmeduni Vienna, bestätigen und erweitern die Ergebnisse der Arbeit die früheren Befunde zur Perspektivenübernahme bei Hunden, denn sie legen ein implizites Verständnis falscher Überzeugungen nahe. „Bei Kindern und Menschenaffen neigt die Fachwelt mehrheitlich zur Ansicht, dass sich aus dem Verständnis falscher Überzeugungen die Fähigkeit zu einer Art von Gedankenlesen ableiten lässt. Der Nachweis beim Hund bedeutet, dass er demnach nicht nur der beste Freund des Menschen, sondern womöglich auch sein verständnisvollster wäre“, so Huber.
Studie bringt vier wichtige Erkenntnisse, Terrier ragen heraus
Inspiriert von früheren Arbeiten mit Menschenkindern und Menschenaffen entwickelten die ForscherInnen, allen voran die Studien-Erstautorin Lucrezia Lonardo, ein nonverbales Spiel, bei dem zwei Hundegruppen die Möglichkeit hatten, Futter in einem von zwei Behältern (Behälter A und B) zu finden. Der Verhaltenstest mit mehr als 200 Hunden brachte vier interessante Ergebnisse.
„Erstens wählten die meisten Hunde den richtigen Behälter B, sie passten offenbar gut auf und ließen sich nicht vom doppelten Verstecken beirren. Das zweite und vielleicht wichtigste Ergebnis war, dass von den restlichen Hunden, welche dem falschen Hinweis folgten, ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Hundegruppen bestand“, sagt Ludwig Huber. Damit kann die Hypothese bestätigt werden, dass Hunde den Unterschied zwischen den Überzeugungen der beiden Kommunikatorinnen im Test erkannten. „Das dritte Ergebnis war überraschend, denn anders als bei Kindern und Menschenaffen taten dies mehr Hunde in der Gruppe der Kommunikatorin mit der falschen Überzeugung.
Das noch überraschendere Ergebnis war jedoch das vierte, dass nämlich das Verhalten in dieser Aufgabe zwischen den Rassegruppen der Hunde (FCI) erheblich variierte, wobei eine Gruppe stark von allen anderen abwich: Terrier (FC 3) verhielten sich wie Menschenkinder und Menschenaffen, indem sie dem irreführenden Hinweis der Kommunikatorin mit falscher Überzeugung seltener folgten“, so Huber weiter.
Studiendesign des Verhaltenstests
Zunächst sahen die Hunde, wie eine Studentin (die „Versteckerin“) nacheinander das Futter zunächst in Behälter A platzierte und später in Behälter B umlagerte. Bevor die Hunde jedoch ihre Wahl treffen durften, erhielten sie von einer anderen Studentin (der „Kommunikatorin“) einen Hinweis auf den Ort des Verstecks, obwohl die Hunde alles sehen konnten. Doch dieser Hinweis war falsch. Würden die Hunde ihrem Wissen oder dem falschen Hinweis der Kommunikatorin folgen?
Um zu verstehen, was Hunde dazu bewegt, wenn sie tatsächlich dem falschen Hinweis folgen, verglichen die WissenschafterInnen das Verhalten von zwei Gruppen von Hunden, welche den Hinweis von einer Kommunikatorin mit unterschiedlichem Wissen bekamen. Eine der beiden konnte nur den ersten Teil der doppelten Versteckprozedur beobachten, das Verstecken des Futters im Behälter A. Danach verließ die Kommunikatorin für kurze Zeit den Raum, während die Versteckerin das Futter aus Behälter A herausnahm, vor den Augen des Hundes vorbeitrug und dann für den Hund gut sichtbar in den Behälter B legte. Somit hatte die Kommunikatorin nach ihrer Rückkehr aufgrund der fehlenden Beobachtung eine falsche Überzeugung über den Ort des Futters. Ihr Hinweis auf den falschen Behälter A könnte mit dieser falschen Überzeugung erklärt werden. Für die andere Hundegruppe hatte die Kommunikatorin eine korrekte Überzeugung über den Ort des Futters, denn sie konnte den Wechsel des Futters zu Behälter B mitverfolgen – auch sie war kurz draußen, aber nicht während der Umlagerung des Futters. Doch auch sie zeigte auf das falsche Versteck. Die Tatsache, dass Hunde – anders als Kinder und Menschenaffen – eher der Kommunikatorin mit der falschen Überzeugung folgen, könnte dadurch erklärt werden, dass die Hunde den (falschen) Vorschlag der unwissenden Kommunikatorin als Fehler nachsahen, den Vorschlag des wissenden Kommunikators aber als betrügerisch oder von einer anderen unbekannten Absicht getrieben. Schließlich sind auch menschliche Gesellschaften im Allgemeinen nachsichtiger gegenüber versehentlichen als gegenüber absichtlichen Verstößen.
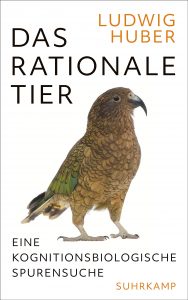 Weitere Informationen:
Weitere Informationen:
Das Buch „Das rationale Tier“ (Autor: Ludwig Huber), in welchem diese und ähnliche Studien beschrieben werden, erscheint im Dezember 2021 im Suhrkamp Verlag:
Originalpublikation:
Der Artikel „Dogs follow human misleading suggestions more often when the informant has a false belief“ von Lucrezia Lonardo, Christoph Völter, Claus Lamm und Ludwig Huber wurde in „Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences“ veröffentlicht. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2021.0906
23.07.2021, Veterinärmedizinische Universität Wien
One Health: Unsere Tiere und wir in Zeiten von COVID-19
Der Ausbruch von COVID-19 im Dezember 2019 hat bisher über drei Millionen Todesopfer gefordert. Von Tier auf Mensch übertragen, gilt COVID-19 als Zoonose mit vermeintlichem Ursprung in Fledermäusen. Anlass zur Sorge gibt nicht nur die Übertragung von Tieren auf Menschen, sondern womöglich ist umgekehrt die revers-zoonotische Übertragung vom Menschen auf sein Haustier noch wichtiger. Vor diesem Hintergrund widmet sich ein aktuelles Positionspapier der Europäischen Akademie für Allergologie und Klinischer Immunologie (EAACI) dem Thema Coronavirus-Erkrankungen bei Mensch und Tier, potentiellen Übertragungswegen zwischen beiden sowie möglichen Maßnahmen.
Die Conclusio: kurzfristig am wirkungsvollsten sind Abstands- und Hygienemaßnahmen für Mensch und Tier, aber langfristig kann wirkungsvolle Prävention von Pandemien nur durch einen ganzheitlichen interdisziplinären Zugang erfolgen.
One Health – ein umfassendes Konzept für das gesamte organische Leben
Menschen, Tiere und Pflanzen sind alle globalen Bedrohungen ausgesetzt. Dem trägt das One Health-Konzept mit einem Paradigmenwechsel Rechnung, indem es weg von einer isolierten Betrachtungsweise das gesamte organische Leben auf unserem Planeten mit einbezieht: Klimawandel, Umweltverschmutzung, industrielle Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung wirken sich auf die Lebensqualität und die öffentliche Gesundheit („Public Health“) aus. Im Bereich der zoonotischen Erkrankungen zeigen aktuelle Resultate unterschiedlicher Forschungsgruppen, dass zahlreiche Faktoren ein erhöhtes Risiko – auch für Coronaviren-Erkrankungen (Corona Virus Disease, COVID) – darstellen: Der Klimawandel und die globale Erwärmung führen zu veränderter Fauna und Flora; die Zerstörung der Lebensräume für Wildtiere und das Vordringen des Menschen dorthin führt zu einem erhöhten Risiko für Übertragung von Infektionskrankheiten von Tier auf Mensch (Zoonosen) und umgekehrt (reverse Zoonose). Ein zusätzliches Risiko stellt die Verarbeitung, unsachgemäße Lagerung und der Verzehr von exotischen, wild-lebenden Tieren dar.
In der aktuellen COVID-19-Pandemie, welche vom SARS-CoV-2 Virus ausgelöst wurde, könnte das Überspringen des Virus von Fledermäusen auf einem chinesischen Markt („wet market“) mit einem möglichen Zwischenwirt der Auslöser gewesen sein. Der weitere Übertragungsweg, vor allem respiratorisch über Aerosole und Tröpfen, aber möglicherweise auch oro-fäkal, erfolgte dann vor allem innerhalb einer Spezies, also von Mensch zu Mensch. Aber der Mensch könnte die Erkrankung dann auch auf Haustiere wie Katzen und Hunde, sowie Zoo- (Tiger, Löwen) und Farmtiere (Nerze) übertragen haben (reverse Zoonose), welche sich dann wieder innerhalb der Spezies rasch verbreiten konnte. Die wichtigsten Beobachtungen derzeit sind, dass umgekehrt die Haustiere wohl für den Menschen keine Gefahr darstellen und eher ein „dead-end“ Wirt sind. Trotzdem haben viele TierbesitzerInnen aus Angst vor Ansteckung ihr Haustier ausgesetzt. Simulationsberechnungen haben aber gezeigt, dass durch diese verfehlte Reaktion das Risiko für eine Weiterverbreitung sogar erhöht sein kann.
Die wichtigsten Verhaltensregeln für den Menschen uns seine Haus- und Hof-Tiere sind daher vor allem in den Hygiene- und Abstandsmaßnahmen zu finden, wie sie derzeit auch zwischen Menschen gelten, mit der Ausnahme, dass Tiere weder desinfiziert werden müssen noch eine Maskenpflicht machbar und sinnvoll ist.
„Die Gefahr von solchen Pandemien steigt“, so die korrespondierende Autorin Isabella Pali-Schöll vom interuniversitären Messerli Forschungsinstitut der Vetmeduni Vienna, Medizinischen Universität Wien und Universität Wien. Die wichtigsten kurzfristigen Präventivmaßnahmen auf Ebene der Gesundheitspolitik sind die genaue Beobachtung von neu auftretenden, unbekannten Symptomen und deren gezielte Testung und Erkennung, sowie rasches Einschreiten im Sinne einer Quarantäne um eine Ausbreitung zu verhindern, und darauf zügig folgend die Entwicklung, Produktion, globale Verteilung und Verabreichung von Impfstoffen und Medikamenten.
Aber dringend müssen dem One Health-Konzept folgend auch rasch systematisch langfristige Maßnahmen gesetzt werden, und zwar auf lokaler, nationaler und globaler Ebene, um die Gefahr von zoonotischen und anderen Erkrankung von Mensch und Tier zu vermindern, so Pali-Schöll. Dazu gehören Erhaltung und Schutz sowie die Wiederherstellung von Lebensräumen für Wildtiere und der Biodiversität, denn Monokulturen und wenig Artenvielfalt bei Boden, Pflanzen, Tieren bieten immer eine Bühne für Krankheiten. Zusätzlich muss aber auch die Aufklärung der betroffenen Bevölkerungsgruppen bezüglich Konsum von exotischen Tieren und hygienischen Haltungs- und Lagerungsbedingungen von Lebensmitteln erfolgen. Unabhängig davon muss der Zugang zu ausreichend Trinkwasser und Nahrung gesichert werden, um damit zoonotischen Erkrankungen bei Mensch und Tier vorzubeugen.
In diesem Sinne müssen Prävention und Management von Pandemien von einem holistischen Zugang erfolgen, mit One Health als optimaler Strategie. Das One Health-Konzept wurde jüngst durch Implementierung einer eigenständigen Arbeitsgruppe (Leitung I. Pali-Schöll) in der Europäischen Akademie für Allergologie und Klinischer Immunologie (EAACI) gewürdigt, in der auch nicht-infektiöse Erkrankungen (non-communicable diseases NCD) inkludierend Allergien bei Mensch und Tier bearbeitet werden.
Originalpublikation:
Der Artikel „One Health: EAACI Position Paper on coronaviruses at the human-animal interface, with a specific focus on comparative and zoonotic aspects of SARS-Cov-2“ von Korath ADJ, Janda J, Untersmayr E, Sokolowska M, Feleszko W, Agache I, Adel Seida A, Hartmann K, Jensen-Jarolim E, Pali-Schöll I wurde in Allergy 2021 veröffentlicht.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34180546/


